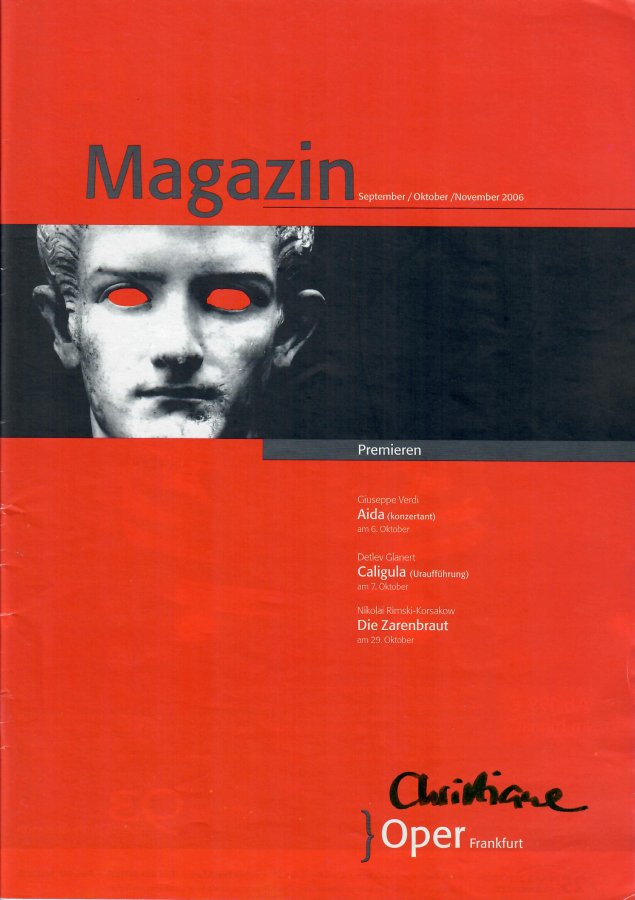- Magazin
- Oper Frankfurt
- September-November 2006 (Scan)
- S. 12-13
Interview
Existentielle Fragestellungen
Detlev Glanert und seine neue Oper Caligula
Text: Norbert Abels
In: Magazin, September-November 2006 (Scan), Oper Frankfurt, S. 12-13 [Publikumszeitschrift]
Über ein halbes Jahrhundert währte das Tabu, Geschichten zu erzählen. Als anachronistisch galt jeder Versuch, etwas von Anfang bis zum Ende zu schildern. Einer abgeschlossenen Handlung unterstellte man eine Ästhetik des Scheins, der erpressten organischen Geschlossenheit. Allenthalben dominierte das Dekonstruktionsgesetz, triumphierte das Fragmentierungsgebot. Es galt für das Verdikt gegen Vollendung in der Lyrik, es galt für lineare narrative Formen und - vor allem - für den aufs Ganze zielenden traditionellen Anspruch des Musiktheaterhandwerks. In Donaueschingen und Darmstadt gerieten Henze und Reimann in die Schusslinie der puristischen Dekonstrukteure.
Erst in den letzten Jahren wird deren poröse Orthodoxie immer offensichtlicher. Seit sich Dekonstruktion zur erstarrten Tradition wandelte, trägt sie selbst alle Züge dessen, was sie den geschlossenen Werken unterstellte. Parallel zum Verfall dieser Ästhetik vollzog sich ein erneuter Aufstieg der am Lebensschicksal orientierten Geschichte.
Im Musiktheater steht seit Jahren Detlev Glanerts Werk für diese Tendenz. Vielleicht, so formulierte er bereits im November 1995 anlässlich der Uraufführung seiner nach Arnold Zweig geschriebenen Oper Der Spiegel des großen Kaisers - ein Versuch über Machtvollkommenheit, Krieg, Tod und Liebe »in der Form des Vergehens« -, mache es die höchst artifizielle Welt und die Faszination der Oper eben gerade aus, dass sie sich in ihren besten Momenten »nur mit den wenigen zentralen Problemen des Menschseins« befasse, diese aber immer wieder neu formuliere und darstelle.
Glanert, 1960 in Hamburg geboren, begann bereits als Jugendlicher zu komponieren. Zu seinen Lehrern gehörte u.a. Hans Werner Henze. Dessen filigranen Umgang mit der menschlichen Stimme und ihrer Begegnung mit dem Orchesterklang gilt auch für alle musikdramatischen Werke Glanerts. Es sind tatsächlich Opern im klassischen Sinne des vom Gesanglichen ausgehenden Primats; darunter auch drei Kammeropern; nach Thornton Wilder, die dreizehn Szenen aufweisende Oper Joseph Süß (Text von Werner Fritsch) sowie - man glaubt es kaum - die »komische Oper« Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung nach Christian Dietrich Grabbe. Hinzu kommt die auch in Frankfurt gespielte Kinderoper Die drei Rätsel.
Ein Grundgedanke aller Bühnenwerke Glanerts ist die Kollision des Einzelnen mit dem Kollektiv. Selbstbehauptung oder Selbstverwirklichung, Isolation und Megalomanie, in Despotismus mutierte Lebensangst und in der Ausgrenzung erst erfahrene Identität: Diese existentiellen Themen bestimmen die Stoffwahl des Komponisten. Auch für Caligula nach Albert Camus ist dies der Fall, freilich mit einer ganz neuen Zuspitzung: »Caligula ist die erste Oper, die ich über das Innenleben, den Seelenzustand einer einzigen Figur schreibe und ihre Wirkung nach außen. Nicht, was mit der Figur geschieht, sondern was sie mit den anderen macht.« Die Idee ist schlagend. Glanert wählt die Perspektive des Protagonisten, der in den Augen der anderen längst die Grenze von Vernunft zum Wahnsinn überschritten hat. Dessen so abgründige wie in sich stimmige Logik wird zum kompositorischen Prisma. Glanert stellt den Einzigen und seinen Kosmos ins Zentrum. Ziel Caligulas ist es, den anderen den »wahrhaft freien Menschen - nämlich sich selbst - gegenüberzustellen.« Dabei aber löst er eine irreversible Dramaturgie der Vernichtung aus, denn, so Glanert: »Wenn man die totale Freiheit demonstrieren will, bedeutet das die Auslöschung alles anderen.«
Um die absurde und paradoxe Grundsituation, in der Freiheit und Macht als identische Größe gelten, im kompositorischen Material festzuhalten, hat Glanert zu einer äußerst originellen Verfahrensweise gegriffen: »Das ganze Stück ist komponiert aus der Physis Caligulas heraus. Das Orchester selbst ist Caligula. Das sind seine Venen, seine Nerven, seine Gehirnzellen, das ist sein Klangkorpus. Wenn die anderen auftreten, hören wir sie so, wie er sie hört. Caligula ist durch den Tod der Drusilla in eine Art Taumel versetzt, in eine Unwucht, die immer größere Kreise zieht. Und das versuche ich klanglich zum Ausdruck zu bringen, indem das Orchester keine Mitten hat. Die mittleren Instrumente sind alle herausgestrichen. Es gibt durchgehend in allen Instrumentengruppen nur Höhen und Tiefen. Das ist ein äußeres Mittel.«
Das zweite Mittel ist ebenso schlagend. Die Oper basiert auf einem einzigen Akkord. »Dieser Akkord besteht aus 27 Noten. Durch sieben Oktaven von oben bis unten. Und zwar mit sich dehnenden und zusammenziehenden Intervallen. Wie Muskeln, wie das Außersichgeraten und Zusammenkrümmen. Das habe ich von Caligula übernommen und auf Musik übertragen. Dieses Krümmen habe ich versucht, wie in einem Spiegel in eine Intervallik zu übersetzen.«
Gut ein Jahrzehnt vor der Fertigstellung des Librettos in Zusammenarbeit mit Hans-Ulrich Treichel und der Anfertigung der Partitur formierte sich der Plan zum Werk, das von Orchesterwerken wie Katafalk, Burleske und Theatrum bestiarum flankiert wurde; gleichsam »Klangstudien, um Räume auszuprobieren - wie die drei Leonoren-Ouvertüren, wenn ich mal ganz arrogant sein darf«.
Detlev Glanerts Musiktheater wird in Caligula abermals Handlungs- und Erzähltheater sein - auch wenn die Handlung gleichsam dem Gehirn der Titelpartie entspringt. Weiterhin gilt als Grundaxiom die Kategorie des Spieles: »Ich denke, dass das Theaterspielen, das Sich-auf-die-Bühne-Stellen, Singen ein zutiefst im Menschen angelegter Wunsch ist. Es ist die Fortführung der Kindheit mit intellektuellen Mitteln. Es bleibt natürlich Spiel.
Wir verifizieren unser Dasein in Form eines Spiels. Wir werfen die Ideen, Gedanken, gesungene Worte hin und her, wir führen vor, tun so als ob - das ist eine Versuchsanordnung in Form eines Spiels. Wer hat das noch gesagt: Das spielende Kind berührt das Göttliche.«
Vielleicht steckt auch im Kaiser Caligula noch dieses Kind.
Der Ruf nach einer Reformation des in vielerlei Hinsicht misslichen Opernbetriebs ist dringend notwendig, aber der Ruf nach der Reform der Gattung Oper ist redundant: Diese wird nicht durch Postulate verordnet durchgeführt werden, sondern sie wird sich durch die Komponisten mit den allein von ihnen gefundenen ästhetischen, musikalischen und szenischen Lösungen vollziehen.
Detlev Clanert
Detlev Glanert wurde 1960 in Hamburg-Bergedorf geboren und lebt seit 1987 in Berlin. Erste Kompositionsversuche unternahm er bereits im Alter von 12 Jahren. Er studierte bei Diether de la Motte, Günter Friedrichs, Frank Michael Beyer sowie vier Jahre bei Hans Werner Henze. 1986 war er Teilnehmer des Sommerkurses in Tanglewood. Begünstigt wurde sein Schaffen durch eine Reihe von Stipendien. Z.B. ermöglichte ihm ein Stipendium des Berliner Opernsenats einen einjährigen Aufenthalt in der Türkei und ab 1989 kam ihm ein Förderstipendium der Rolf-Liebermann-Gesellschaft für sein erstes großes Opernwerk, Der Spiegel des großen Kaisers, zugute, das von zwei auf vier Jahre verlängert wurde. 1992/93 weilte er als Stipendiat der Deutschen Akademie »Villa Massimo« in Rom, 1999 folgte ein Stipendium der »Villa Aurora« in Los Angeles. Besonders erfolgreich sind seine Opern Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung von 2001 und Die drei Rätsel, durch die Glanert 2005/06 auch dem Frankfurter Publikum bekannt wurde. Hinzu kommen Joseph Süß, die Märchenoper Leyla und Medjnun, die Kammeropern Drei Wasserspiele nach Thornton Wilder und zahlreiche Orchester-, Kammermusik- und Klavierwerke.
- Quelle:
- Magazin
- Oper Frankfurt
- September-November 2006 (Scan)
- S. 12-13
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe