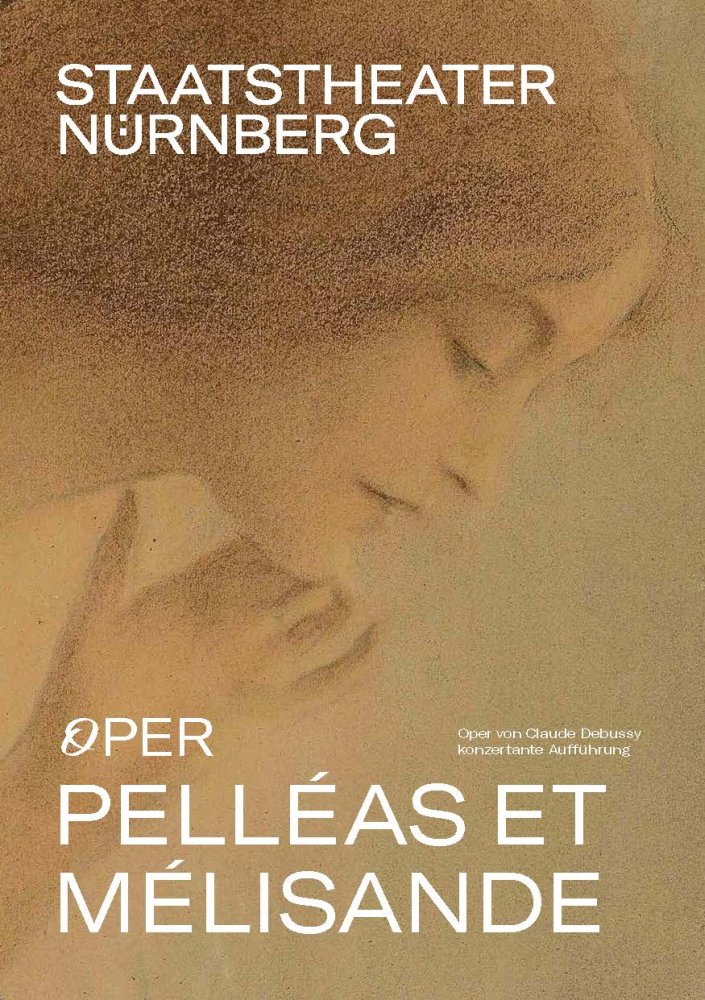- Pelléas et Mélisande
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Claude Debussy, konzertante Aufführung, Saison 2021/22 (Auszug)
- S. 11-15
Die schönste aller Lügen
Text: Georg Holzer
In: Pelléas et Mélisande, Oper von Claude Debussy, konzertante Aufführung, Saison 2021/22 (Auszug), Staatstheater Nürnberg, S. 11-15 [Programmheft]
Der Kunstform Oper stand Claude Debussy misstrauisch gegenüber. Auch wenn von ihm der Satz „L’art est le plus beau des mensonges“ – „Die Kunst ist die schönste aller Lügen“ – überliefert ist, trieb es seiner Meinung nach die Oper mit ihren Lügen ein bisschen zu weit. Ihm grauste schon vor dem neuen Gebäude der Pariser Oper, dem Palais Garnier, das er für die Fusion eines Bahnhofs mit einem türkischen Bad hielt. Der Opernbetrieb mit seinem Pragmatismus und seinen Schlampereien war dem Perfektionisten Debussy zuwider. Auch die ständige Jagd nach Wirkungen stieß ihn ab: „In der Oper wird nicht ‚geflirtet‘, man schreit dort sehr laut unverständliche Texte. Wenn man einander Liebe schwört, donnern dazu die Posaunen. Logischerweise müssen die schillernden Nuancen eines Gefühls in so viel pflichtgemäßem Getöse untergehen.“ Als junger Mann hatten ihn Richard Wagners Musikdramen beeindruckt und beeinflusst, doch ein Wagnerianer, wie sie am Ende des 19. Jahrhunderts in Paris häufig anzutreffen waren, war er nicht geworden. Für ihn war Wagner eher der Vollender einer alten Musik als der Prophet einer neuen. Als solchen sah Debussy, für den Bescheidenheit keine besondere Tugend war, eher sich selbst.
Nicht von dieser Welt
Natürlich kam auch ein Debussy nicht aus dem Nichts und nahm viele musikalische Einflüsse früherer Meister auf. Doch was die Oper betrifft, ist es ihm mit seinem einzigen Opernwerk „Pelléas et Mélisande“ tatsächlich gelungen, einen völlig neuen Weg einzuschlagen. „Pelléas et Mélisande“ unterscheidet sich sehr deutlich von dem, was damals an neuen Opern auf europäischen Bühnen zu hören war. Das beginnt beim Textbuch. Debussy hatte schon Mitte der 1890er Jahre ein Auge auf ein Stück des belgischen Symbolisten Maurice Maeterlinck geworfen, das so aus der Zeit gefallen schien wie die ganze Kunst des Symbolismus. Sie hatte sich als Reaktion auf das zunehmende Monopol des Realismus und Naturalismus gebildet, die das Theater und die Prosa bestimmten. Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Louÿs, Huysmans, Maeterlinck und viele andere hatten keine Lust, ihre Kunst dem Diktat der Wirklichkeit zu unterwerfen. Ihre Gedichte, Stücke und Romane waren nicht von dieser Welt und wollten es nicht sein. Sie suchten in ihren Schriften nach einem Kontrapunkt zum Rationalismus der industriellen Revolution. Das musste Debussy gefallen, der an der Wirklichkeit seiner Zeit wenig Inspirierendes fand.
Figuren ohne Hintergedanken
Sicher kann die Geschichte von Pelléas und Mélisande, die sich ineinander verlieben, obwohl Mélisande die Frau von Pelléas’ Bruder Golaud ist, eine gewisse Verwandtschaft mit Wagners „Tristan und Isolde“ nicht verleugnen. Vor allem die Verlegung eines psychologisch genau geschilderten Liebeskonfliktes in ein mythisches Vorgestern haben die beiden Werke gemeinsam.
Die Gemeinsamkeiten zwischen „Pelléas“ und „Tristan“ hören hier noch nicht auf, doch schon im Libretto zeigen sich deutliche Unterschiede. Wagners Text hat bei aller Genauigkeit in der Schilderung der Emotionen einen expressiven Gestus, ist oft sehr pathetisch und immer auf der Suche nach großen Wirkungen. Maeterlincks Theaterstück ist in fast jeder Hinsicht das Gegenteil. Es zeigt heftige, tödliche Leidenschaften, aber es versucht ständig, sie zu unterspielen. Das gegenseitige Liebesgeständnis von Pelléas und Mélisande trumpft nicht auf wie das von Tristan und Isolde. Sie entreißen es sich nicht, es passiert ihnen wie nebenbei und lässt sie verwirrt zurück, vor allem Pelléas, der Mélisandes Liebe zu ihm noch überraschender findet als seine eigene zu ihr. Von Anfang an hat man den Eindruck, dass die Figuren in ihre Beziehungen hineinstolpern: Golaud findet Mélisande im Wald und verliebt sich in sie; warum sie ihn heiratet, obwohl sie ihn nicht liebt, erfahren wir nicht. Pelléas und Mélisande sitzen stunden- und tagelang nebeneinander und schweigen sich an, bevor sie sich wie versehentlich ihre Liebe gestehen. Sogar der alte König Arkel kommt im Gespräch plötzlich darauf, dass ihm Mélisandes Zärtlichkeit gut tun würde. Immer stolpern in diesem Stück die Figuren über ihre Worte, verheddern sich in ihnen, verraten sich, wo sie sich eigentlich verbergen möchten.
„Pelléas et Mélisande“ gilt als eine der rätselhaftesten Opern des großen Repertoires. Vielleicht deshalb, weil sie im Kontext des Symbolismus steht, der das Schwerverständliche zum poetischen Programm erhoben hatte, eben um sich von der Oberflächlichkeit der Welt radikal abzugrenzen. Schaut man sich das Stück aber genauer an, bleibt von den vermeintlichen Rätseln nicht viel übrig. Maeterlincks Sprache ist ebenso einfach und klar wie die Motivationen der Figuren. Golaud fasst das in einem prägnanten Satz zusammen: „Je n’ai pas d’arrière-pensée… Si j’avais une arrière-pensée pourqoui ne la dirais-je pas?“ (Ich habe keinen Hintergedanken… Wenn ich einen hätte, warum sollte ich ihn nicht sagen?“) Oft erklären sich die Figuren so deutlich, dass es komisch wird, etwa wenn Mélisande auf Pelléas’ Frage, ob er sie anlüge, freimütig antwortet: „Ich lüge nie wen an. Nur deinen Bruder.“ Oder sie betrügen sich selbst so offensichtlich, dass sie sich selbst nicht mehr glauben können, wie Golaud, der die Liebe zwischen Pelléas und Mélisande nicht wahrhaben will und sie zur Kinderei erklärt, bis er schließlich nicht mehr wegschauen kann und alle Beherrschung verliert. Arkel sagt am Ende über Mélisande, sie sei „un pauvre petit être mystérieux comme tout le monde“ gewesen („ein armes kleines Wesen, mysteriös wie alle“). So steht es mit den Menschen in dieser Oper: Sie sind so geheimnisvoll wie jeder Mensch, wenn man bereit ist, mehr von ihm wahrzunehmen als die sichtbare Oberfläche.
Der Aufstand der Jungen
Golauds Mord an Pelléas, der in der Folge auch Mélisandes Leben kostet, ist umso tragischer, als er die Falschen erwischt. Deshalb ist Golaud am Ende der Oper so untröstlich: Er hat seine Verbündeten getötet und den wahren Gegnern in die Hände gespielt. Denn der wirkliche Konflikt des Stücks verläuft nicht innerhalb des fatalen Liebesdreiecks Mélisande, Golaud und Pelléas, sondern zwischen den Generationen.
Golaud und Pelléas sind in eine kalte Welt geworfen. Ihr Großvater Arkel regiert von seiner düsteren Burg aus das Reich Allemonde (der Anklang an „Allemagne“ ist sicher kein Zufall), in dem die Bettler am Strand schlafen und die Bauern am Hunger sterben wie die Fliegen. Geneviève, die Mutter der Halbbrüder, hat sich in ihr Schicksal gefügt; Pelléas’ Vater, der nicht einmal einen Namen bekommt, siecht todkrank vor sich hin. Der alte Arkel hat Golaud zum Nachfolger ausersehen, aber als der die dahergelaufene Mélisande heiratet, gibt er ihn auf. Er muss erkennen, dass der Enkel nicht die für einen Herrscher nötige Gefühllosigkeit mitbringt. Das Weichei Pelléas wäre dem Job ohnehin nicht gewachsen, das sieht man auf den ersten Blick. Wie ein Vampir stürzt sich Arkel am Ende auf Mélisandes Tochter, von der wir nicht wissen, ob Golaud oder Pelléas ihr Vater ist. Wer weiß, wie die Urenkelin mit dem finsteren Erbe des Patriarchen umgehen wird.
Mélisande ist die „intruse“, der Eindringling (so lautet der Titel eines frühen Maeterlinck-Stücks), der die kranke Familie implodieren lässt. Sie ist selbst aus einer unerträglichen Situation geflohen, als Golaud sie im Wald aufsammelt, allerdings erfahren wir nicht, was ihr passiert ist. Sie ist durchaus nicht die reine, unschuldige Kindfrau, als die sie Golaud und Arkel sehen wollen. Sie heiratet mit Berechnung in eine mächtige Familie ein und versucht, für sich das Beste aus der Situation herauszuholen. Am steifen, dunklen Hof von Allemonde und als Gattin des ungeliebten Golaud kann sie aber nicht aufblühen, erst das Zusammentreffen mit ihrem Schwager Pelléas befreit sie von allem Schweren, das auf ihr lastet. Golaud erkennt das schnell und ist eifersüchtig, redet sich das Dreiecksverhältnis aber schön: Er selbst, sein geliebter Bruder und seine geliebte Frau sollen der Kälte von Arkels Welt eine neue Zeit der Freundschaft und Liebe entgegensetzen. Aber so gütig ist die Liebe nicht. Golaud liebt Mélisande und betrachtet sie als seinen Besitz. Dass sie und Pelléas ihn verraten, kann er nicht ertragen.
Ein Fluss der Sprache und Musik
Debussys Musik gleicht einem Fluss, der sich seinen Weg bahnt – mit Stromschnellen und Untiefen, aber ohne Staumauer. Debussy misstraut gesuchten, aufgesetzten Wirkungen. Er entwickelt die Dramatik aus dem, was zwischen den Figuren passiert. Der Gesang entsteht aus der Deklamation. Es geht um Text, Haltungen und Charakteristik, nicht um Virtuosität. Auf eines der beliebtesten und wirkungsmächtigsten Stimmfächer seiner Zeit, den Heldentenor, verzichtet Debussy von vornherein. Seine Lieblingsintervalle sind Sekunden und Terzen, also keine auftrumpfenden Intervallsprünge, eher eine ewige, ununterbrochene, unspektakuläre Melodie. Mit höchster Kunst schafft Debussy einen Gestus der Schlichtheit und Eindringlichkeit. Bravour-Arien und Ohrwürmer sucht man in „Pelléas et Mélisande“ vergeblich. Debussys Herangehensweise bezieht sich weniger auf die Opern seiner Zeitgenossen als auf die Meister des Barocks und ihr „recitar cantando“, die singende Rezitation. Die Musik und die Farben des Orchesters orientieren sich am Rhythmus des gesprochenen Textes. Die Klarheit der Musik entspricht Maeterlincks schnörkelloser Sprache, die bei allem Anspielungsreichtum das Pathos und die Vergrößerung meidet. Maeterlincks bevorzugtes Satzzeichen sind die drei Punkte am Ende einer Phrase, sodass nie kaum ein Satz wirklich abgeschlossen ist und sich die Figuren und Situationen nie ganz festlegen lassen. Immer ist alles im Fluss, wie die Musik, wie das Leben.
- Quelle:
- Pelléas et Mélisande
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Claude Debussy, konzertante Aufführung, Saison 2021/22 (Auszug)
- S. 11-15
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe