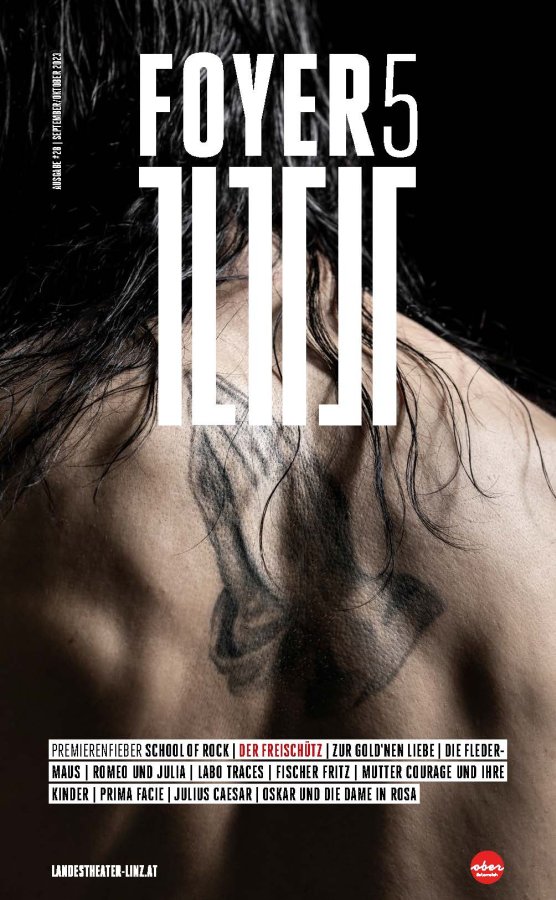- Foyer5
- Landestheater Linz
- #28 | September / Oktober 2023
- S. 60-61
Das Rätsel eines Genies
Text: Markus Poschner
In: Foyer5, #28 | September / Oktober 2023, Landestheater Linz, S. 60-61 [Publikumszeitschrift]
Nach so vielen Jahren der intensivsten Auseinandersetzung und Begegnung mit Anton Bruckner, nach unzähligen Aufführungen und Aufnahmen seiner Werke muss ich gestehen: Er bleibt für mich dennoch ein unlösbares Rätsel.
Da ist so viel Beunruhigendes, Irritierendes und Widersprüchliches, Bruckner ist nichts Geschlossenes, er bleibt unbekannt und entzieht sich neugierigen Annäherungsversuchen. Man möchte fast denken, da waren Medienprofis am Werk, um ihn vor den Blicken einer aufdringlichen Öffentlichkeit zu schützen, durch geschickte Verschleierung und gezielte Anekdoten. In Wahrheit leistete er sich einfach nur, unangepasst zu sein. Und doch aber braucht es jedes Mal nur einen winzigen Augenblick, um sich in seiner Musik vollständig zu verlieren, um in andere geheimnisvolle Welten weggetragen zu werden. Kaum ein Komponist ließ sich jemals über seine Musik so tief in die Seele blicken, alles erscheint plötzlich unfassbar vertraut, tief und verständlich.
Wie ist das möglich? Wie ist es überhaupt zu verstehen, dass der gebürtige Ansfeldner und spätere Hilfslehrer aus Windhaag Weltmusik schrieb, die uns noch heute, 200 Jahre nach seiner Geburt, auf der ganzen Welt und über alle Kulturgrenzen hinweg in ihren Bann zieht? Er begann weder als Wunderkind noch als Genie, war bereits weit über 30 Jahre alt, als er sich ernsthaft mit Komponieren beschäftigte, und über 40 Jahre alt, als er endlich seine erste Sinfonie öffentlich präsentierte. Er lebte also weit mehr als ein halbes Leben lang ein vollkommen unscheinbares, kleinbürgerliches Leben in der oberösterreichischen Provinz als Kirchenmusiker und Schulgehilfe, ganz bei sich, abgekapselt, unbeobachtet und geschützt vor dem Licht der Öffentlichkeit.
Und vermutlich nimmt genau da das Rätsel um das späte Genie Bruckner seinen Anfang. Sinfoniker zu sein, muss für ihn so etwas wie eine göttliche Bestimmung gewesen sein, wobei Zeit dabei absolut keine Rolle spielte. Viel wichtiger waren Kompetenz und Meisterschaft, das Lernen des Handwerks und das Verstehen der Tradition. Mit der grandiosen Bibliothek des prächtigen Stifts St. Florian stand ihm ohnehin auch der größtmögliche Wissensschatz der damaligen Zeit uneingeschränkt zur Verfügung, quasi eine riesige historische Google-Maschine. Und seine Vision, ja noch mehr seine Mission war von gigantischem Ausmaß: Er suchte sein Leben lang nach nichts weniger als dem perfekten Kunstwerk mit den perfekten Proportionen. Jede weitere neue Sinfonie sollte eine noch bessere Annäherung sein an das unerreichbare Idealbild, mit noch gigantischerer Auflösung und Verfeinerung. Und tatsächlich brachte Bruckner schier alle musikalischen Parameter des 19. Jahrhunderts an die Grenze, besonders aber die Zeit. Er fand seinen Archetypus in der Sinfonie und über diese zur Idee der Monumentalität, der Entladung, der Durchbrüche und der Expansion.
Stellvertretend für die extremen Gegensätze und scharfen Kontraste in seinen Werken stehen wohl exemplarisch der Choral und die Polka – sozusagen musikalische Synonyme für Kirche und Wirtshaus und damit wiederum nichts anderes als ein Abbild seines gesamten für ihn denkbaren Weltkreises. Wenn, wie in seiner dritten Sinfonie, die Themen aus Tristan und Isolde direkt mit einer frechen böhmischen Polka verbunden werden, ist Bruckner ganz bei sich: unerreichbar, phänomenal, avantgardistisch. Bruckner denkt in anderen Kategorien – damit ist er ein Solitär und tatsächlich mit keinem anderen Komponisten seiner Zeit vergleichbar.
Nicht mehr das Drama, sondern der Ritus steht im Zentrum seines Denkens und Fühlens, seine Musik ist post-dramatisch. Selbst seine eigenen knappen Versuche, einem ratlosen und vollkommen überforderten Publikum seine Sinfonien über naive programmatische Hilfestellungen näherzubringen, vermögen nicht, das Gesagte auch nur annähernd einzufangen oder abzubilden. Ganz im Gegenteil: Die Hilflosigkeit und Belustigung seines Publikums vergrößerte sich nur um ein Zigfaches. Das Erlebbare in seiner Musik entbehrt völlig – wie bei jeder großen Kunst – der Beschreibung und entzieht sich jeglichen Programms, ähnlich einem Gipfelerlebnis nach langem Aufstieg.
Nach wie vor allerdings und ironischerweise wie schon zu seinen Lebzeiten sehen wir uns auch heute immer wieder konfrontiert mit einem trügerischen Bild von Bruckner: Der vermeintliche Musikant Gottes wird durch pathetische Interpretationswucht in allzu abgeschliffenen Aufführungen im permanenten Überwältigungsmodus auf dem Altar der Geschmacklosigkeiten bei dichtem Weihrauchdunst geopfert.
Mehr Missverständnis ist eigentlich kaum möglich, dies aber scheint sozusagen mitkomponiert. Aber wie sollte es auch anders sein bei einem Komponisten, dessen eigentliches Thema das Disparate ist? Sein Konzept war nicht mehr steigerungsfähig, seine letzte Sinfonie blieb unvollendet – mehr Symbolik ist auch hier kaum möglich. Und uns bleibt nur, staunend davor zu stehen und uns zu verneigen – wie schon seinerzeit seine Magnifizenz, der Rektor der Wiener Universität, bei seiner Laudatio im Jahre 1891 – vor dem Schulgehilfen aus Windhaag.
- Quelle:
- Foyer5
- Landestheater Linz
- #28 | September / Oktober 2023
- S. 60-61
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe