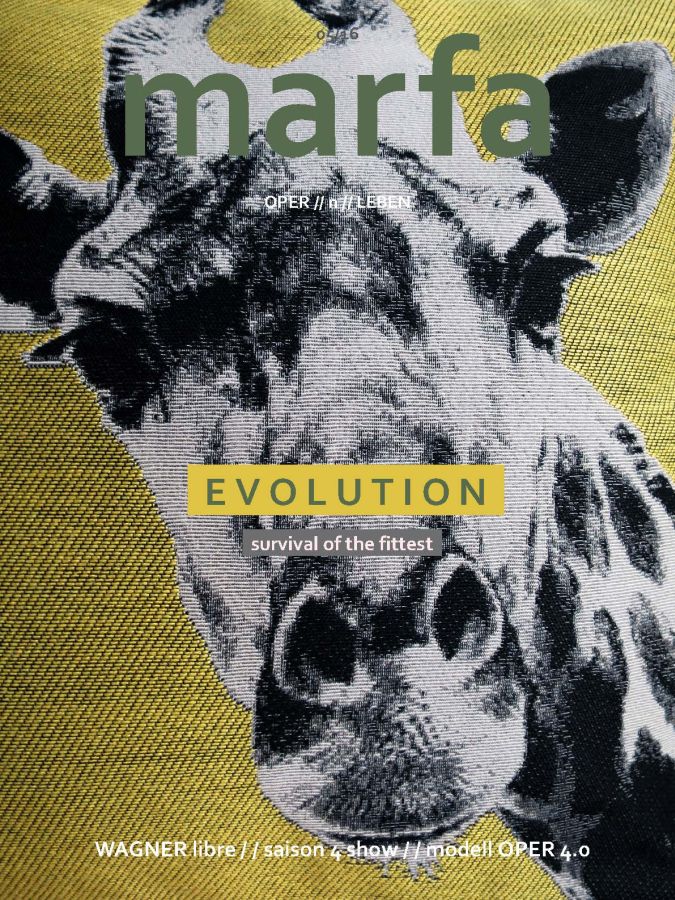- Marfa
- Alexander Busche
- 05/16 | Evolution. Survival of the fittest (Auszug)
- S. 10-20
Wagner libre
Barack Obama, die Rolling Stones und Karl Lagerfeld flogen in diesem Jahr bereits nach Kuba. Auch Marfa-Autor Stephan Burianek. Zufällig spielte man in Havanna gerade eine Oper: Erstmals wurde der „Tannhäuser“ aufgeführt. Es war eine schwierige, aber wichtige Geburt.
Text: Stephan Burianek
In: Marfa, 05/16 | Evolution. Survival of the fittest (Auszug), Alexander Busche, S. 10-20 [Magazin]
Ein Mann verlässt den Ort der ewigen Lust, weil er sich nach Schmerzen sehnt. – Das erscheint einem Kubaner schon seltsam genug. Aber warum, bitteschön, soll der Chor erschrecken, wenn dieser Mann wenig später die Erfüllung von körperlichen Sehnsüchten preist? Das musste der Regisseur Andreas Baesler seinen Chorsängern erst einmal erklären.
Noch nie zuvor hatte man Richard Wagners „Tannhäuser“ szenisch in Kuba erleben können. Dabei verfügt die Hauptstadt der größten Karibikinsel mit dem Gran Teatro de La Habana über ein gleichermaßen geschichtsträchtiges wie prächtiges Opernhaus. Seine eklektizistische Fassade und die schmucken Ecktürme lassen zunächst eher an ein klassisches Grandhotel oder an einen gründerzeitlichen Einkaufstempel à la Harrods denken. In der Eingangshalle und im riesigen, stuckverzierten Ballsaal zeugt der verschwenderische Einsatz von Carrara-Marmor von jenem kunstvollen Spagat zwischen höchster Eleganz und gewolltem Protz, wie er für das einst schwerreiche Havanna typisch war. Bei der Gestaltung des großen Zuschauerraums, dem Sala F. García Lorca, ließen sich die Architekten in Bezug auf Form und Ausmaßen von der Mailänder Scala inspirieren.
Dieses Juwel, in dem bereits Enrico Caruso sang, ist nach einer dreijährigen Renovierungsdauer seit wenigen Monaten wieder öffentlich zugänglich. Obwohl als Opernhaus errichtet, muss sich die nationale Opernkompanie, das Teatro Lírico Nacional de Cuba, diese Spielstätte mit drei Tanzgruppen teilen. Der Tanz ist auf Kuba eben wichtiger als die Oper, wohl auch, weil er dem kommunistischen Regime lange Zeit besser ins Konzept passte. Es überrascht nicht, dass anlässlich der Wiedereröffnung die Bezeichnung des Theaters um den Namen der einst größten Primaballerina Kubas erweitert wurde und nun offiziell Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso heißt.
Umkämpftes Juwel
Die Vierteilung in der Spielplangestaltung macht eine Fixierung der Aufführungstermine freilich schwierig. Fix ist außerdem auf Kuba gar nichts. Denn wenn die Politik das Theater braucht, dann hat die holde Kunst Pause. So geschehen im März beim Besuch von US-Präsident Obama, der für die besagte Produktion beinahe den Todesschuss bedeutet hätte. Obama hielt seine vielbeachtete Rede im Gran Teatro just zu einem Zeitpunkt, an dem die Proben auf der Hauptbühne vorgesehen waren. Daran war dann aber tagelang nicht zu denken.
Improvisation ist in Kuba der Schlüssel zum Überleben. Das weiß der deutsche Regisseur Andreas Baesler, immerhin lebt er seit einigen Jahren mit seiner Familie auf der Insel. „Man muss die Mentalität der Kubaner verstehen, um hier fruchtbar arbeiten zu können“, sagt er am Tag der Premiere in der Pastelería Francesa, einer französisch inspirierten Konditorei nahe des Theaters. Zum Gespräch mit Marfa hat Baesler den Österreicher Walter Gugerbauer und den Schweizer Stefan Bolliger mitgebracht. Dieses deutschsprachige Trio bildete gemeinsam mit der Choreografin Isabel Bustos das Leading Team des kubanischen „Tannhäusers“. Sie alle haben bereits Erfahrungen mit Havanna. Gugerbauer, damals Generalmusikdirektor in Erfurt, dirigierte bereits vor sieben Jahren eine auf Spanisch gesungene und von Baesler inszenierte „Flauta Magica“, die kubanische Erstaufführung von Mozarts „Zauberflöte“, und der Lichtdesigner Bollinger war vor zwei Jahren bei der vielbeachteten Erstaufführung von Richard Wagners „Fliegendem Holländer“ (Regie: Baesler) mit von der Partie, die damals im riesigen Nationaltheater am Platz der Revolution realisiert wurde und zugleich die erste deutschsprachige Opernaufführung in der kubanischen Geschichte war.
Das Team kennt die Besonderheiten in der Arbeit mit kubanischen Künstlern. „Wenn Künstler zu spät kommen, muss man dafür Verständnis haben“, so Gugerbauer, „oft haben sie eine weite Anreise und die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht immer verlässlich.“ Selbst wenn ein Musiker mal gar nicht erscheint, müsse man nachsichtig sein. „Ein Orchestermitglied verdient hier rund zehn Euro im Monat. Das muss man sich einmal vorstellen! Natürlich müssen die Musiker durch andere Jobs überleben, die sich mit den Probezeiten überschneiden können.“ Zum Beispiel Jobs in der Tourismuswirtschaft: Musiker, die in einem Touristenlokal oder in einem Hotel spielen, verdienen dort mitunter an einem Tag so viel wie ansonsten in einem ganzen Monat im Orchestergraben.
„Schwierig wird es, wenn bei den Proben bestimmte Instrumente gänzlich fehlen“, klagt Gugerbauer, „Man braucht im ‚Tannhäuser‘ nun einmal eine Bassklarinette.“ Oder zumindest eine Harfe: In ganz Kuba gibt es aber nur drei Harfenistinnen. Wenn der ersten die Noten zu schwierig sind, die zweite einen Todesfall in der Familie zu beklagen hat und der dritten letztlich nur mehr eine Woche zur Einstudierung bleibt, dann greift man zu unkonventionellen Mitteln: Die Harfe kam im „Tannhäuser“ vom Band, eingespielt von einem Keyboard, was überraschenderweise kaum auffiel.
Und dann natürlich Obama. Der kostete der Produktion praktisch die gesamte Probezeit auf der Hauptbühne. Um auf dieser wenigstens zweieinhalb Probetage absolvieren zu können, wurde die erste von ohnehin nur drei geplanten Vorstellungen kurzerhand zur Generalprobe umfunktioniert.
Das sind ganz schön viele Herausforderungen für lediglich zwei Vorstellungen. Warum tut man sich das an, zumal das Team quasi ehrenamtlich arbeitet, wie Gugerbauer betont? „Weil die Musiker hier unglaublich dankbar dafür sind, etwas Neues kennen zu lernen“, so Gugerbauer, „außerdem durchlebt man die Stücke als Dirigent ebenfalls auf eine neue Art. In Europa brauche ich keinem Musiker die Grundlagen zu Richard Wagner erklären, das ist in Kuba anders. Man hat gleichsam einen Lehrauftrag und man setzt sich mit dem Werk viel grundlegender auseinander.“ Auch Lichtdesigner Bollinger sieht in dem Know-How-Transfer eine Art Entwicklungshilfe: „Wir zeigen den Technikern die Möglichkeiten der ihrer neuen Bühnentechnik, die die Renovierung des Theaters mit sich brachte, und hoffen, dass sie in Zukunft mit diesem Wissen besser arbeiten können.“
Beachtliche Produktion
Bollingers Lichtregie spielte im havannischen „Tannhäuser“, der die Weite des Bühnenraums zelebrierte, einen wichtigen Aspekt. In intensives Grün, Rot oder Blau getaucht, unterstrich der schlichte Prospekt im Hintergrund die Grundstimmung der jeweiligen Handlungsabschnitte. Als Versatzstücke dienten Arbeiten von Kubas nationalem Vorzeigekünstler Alexis Leyva Machado alias KCHO, dessen Studio sich in Havannas Stadtteil Miramar befindet und Besuchern offensteht. KCHOs Vorliebe für Paddeln und Holzboote zeigte sich sowohl in jenen Betten, die das Bühnenbild für die Venusbergszene bildeten, als auch in jener riesigen Denkerskulptur, die dem Schlussakt ein ikonisches Erscheinungsbild gaben. KCHOs Denker spielt auf Auguste Rodins gleichnamige Skulptur an, blickt aber in die Ferne statt gen Boden. Ein Kubaner, soll KCHO gesagt haben, trage sein Haupt stets aufrecht. Ebenso wie Tannhäuser.
Generell war die Einbindung von kubanischen Künstlern unterschiedlicher Gattungen und Stilrichtungen die große Stärke der Produktion. Choreografiert von ihrer Gründerin Isabel Bustos unterstützten die Solisten der erstklassigen Tanztheater-Kompanie Retazos mit einer Verdoppelung der Hauptfiguren die darstellerische Ausdruckskraft der Handlung, und im Kollektiv legte die Truppe die Oberflächlichkeit und die Selbstverliebtheit einer von schrägen Eitelkeiten infizierten Wartburggesellschaft frei. Diesen Job hätte eigentlich eine andere Tanztruppe übernehmen sollen. Bei einem Auslandsgastspiel waren dieser aber derart viele Tänzer abhanden gekommen, dass sie das Engagement, gerade noch rechtzeitig, zurücklegen musste.
Gespielt wurde eine höchst individuelle Version der Oper, deren Grundlage die Dresdner Fassung bildete und die um das Bacchanal der Pariser Fassung erweitert wurde. Die erste große Überraschung gabe es gleich zu Beginn: Die Ouvertüre wurde nicht vom Orchester gespielt, sondern von einem Salonorchester auf der Bühne, das sich aus Mitgliedern des Lyceum Mozartiano de La Habana zusammensetzte – einer vor sieben Jahren mit finanziellen Mitteln der EU und unter der künstlerischen Aufsicht des Salzburger Mozarteums gegründeten Initiative zur Förderung des musikalischen Potenzials der Insel (dessen Finanzierung zwischenzeitlich leider ausgelaufen ist).
Den Tannhäuser gab Yuri Hernández, der es vor vielen Jahren ins Finale des Belvedere-Gesangswettbewerbs in Wien geschafft und danach eine Zeit lang in Linz gesungen hatte. Bei der Premiere zunächst noch unsicher, glänzte er in der zweiten Vorstellung mit überzeugenden Momenten. Die Rolle der Elisabeth teilten sich zwei Sängerinnen: Am Premierenabend sang Johana Simón, herrlich schön lyrisch und trotzdem mit einer Kraft, die sich auch an anderen internationalen Häusern bewähren könnte. In der Folgevorstellung war Milagros de los Ángeles zu hören, die mit ihrem dramatischen Sopran einen spannenden Kontrast zum Vorabend bot. Herrlich souverän führte der Mexikaner Jorge Martínez Mendoza, ein Mitglied des Landestheaters Schleswig-Holstein, seine klangschöne Baritonstimme durch die Partie des Wolframs von Eschenbach. Alioska Jiménez schlug sich in der fordernden Venus-Partie wacker. Eine weitere Überraschung war der erstklassige Klang des kubanischen ICRT-Fernsehchors, der einmal mehr auf das immense künstlerische Potenzial hinwies, das Kuba der Welt zu bieten hätte.
Es war eine wahrlich bemerkenswerte Produktion, der man eine baldige Wiederaufnahme, wo auch immer, wünschen würde. Wären nur mehr Menschen im Publikum gesessen! Der 1.500 Sitzplätze fassende Zuschauerraum war an beiden Tagen maximal zur Hälfte gefüllt. Ein guter Teil davon waren vermutlich Angehörige der Mitwirkenden. Obwohl mit zunehmender Dauer der Vorstellung von Erschöpfungszuständen geplagt, war ihr Jubel beim Schlussapplaus groß. Einige Touristen hatten sich ebenfalls in die beiden Vorstellungen verirrt. Viele davon hatten erst am jeweiligen Tag der Vorstellung von der Produktion erfahren.
Selbst der Autor dieses Textes wusste bei seiner Flugbuchung noch nichts von einer „Tannhäuser“-Produktion. Ein Blick auf die Homepage des Teatro Lírico vor Abflug war wenig ermutigend: Das letzte Update stammt aus dem Jahr 2012, ebenso wenig war der Spielplan des Gran Teatro online auffindbar gewesen. Und selbst wer vom „Tannhäuser“ wusste, der konnte sich seine Karten nur schwer vorab reservieren lassen. Am Telefon wurde Interessenten mitgeteilt, dass die Vorstellungen bereits ausverkauft seien. Der Hintergrund: Vor dem Theatereingang verkaufen allabendlich Verwandte der Kartenverkaufsmitarbeiter die Eintrittskarten zu einem mehrfach erhöhten Preis, und die müssen ja auch von etwas leben.
Ungewisse Zukunft
War dieser „Tannhäuser“, der maßgeblich vom Richard Wagner-Verband in München sowie von den Botschaften Deutschlands und Österreichs finanziert wurde, ein Geschenk, das man nicht ablehnen konnte? Dieser Verdacht kommt am Tag nach der Premiere auf, als wir den Direktor des Teatro Lírico Nacional de Cuba, Roberto Chorens, besuchen.
Chorens – gesetztes Alter, beleibt, Brille – stellt einen Handlungsbedarf in Sachen Oper in Abrede: „Man kennt Wagner hier aus dem Konzertsaal, wo seine Ouvertüren immer schon gespielt wurden, aber die italienische Oper ist den Kubanern einfach näher. Hätten wir stattdessen etwas von Verdi oder Puccini gespielt, dann wäre das Haus voll gewesen.“ Eine Aussage, die auf eine beachtliche Lücke in der Vermittlung des klassischen Opernrepertoirs hindeutet. Wir fragen Chorens, der zugleich Präsident des erst vor zwei Jahren in Havanna gegründeten Richard-Wagner-Verbands ist, nach den Tätigkeiten „seines“ Vereins. „Das ist alles sehr schwierig.“ Viel mehr sagt er dazu nicht. Der Verein ist praktisch inaktiv, habe aber 50 Mitglieder, immerhin. Überhaupt könne sich Chorens frühestens in zwei Jahren eine weitere Wagner-Aufführung vorstellen. Chorens wirkt ein wenig so, als hätte er seine Visionen schon lange an den Nagel gehängt und als sei er froh, wenn er das alte Rad irgendwie am Laufen halten könne. Auch die schlummernde Internet-Präsenz des Teatro Lírico, auf der immer noch Chorens Vor-Vorgänger als Direktor genannt wird, scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Man habe hier eben andere Probleme.
Vielleicht um zu beweisen, dass sich auf Kuba in Sachen Oper doch mehr tut als wir zu glauben geneigt sind, drückt uns Chorens zum Abschied eine DVD in die Hand. Auf ihr ist die Uraufführung von „Cubanacan“ aus dem vergangenen Jahr zu sehen, der ersten kubanischen Oper seit 50 Jahren. Die Musik von Roberto Valera, der darin kubanische Rhythmen geschickt mit einer klassischen Klangästhetik verband, klingt durchaus ansprechend. Die Story könnte indes spannender sein: Che Guevara und Fidel Castro beschließen bei einem Golfspiel den Bau eines Kunstzentrums…
Ohne Konzessionen an die kubanischen Verhältnisse wird der Anschluss der kubanischen Oper ans 21. Jahrhundert nicht gehen. Das dachte sich wohl auch das „Tannhäuser“-Regieteam, das den Titelhelden letztlich am Leben lässt. In Anbetracht der toten Elisabeth zieht er die Venus seinem Tod vor. Am Ende siegt also die Lust. Das musste man den Kubanern bestimmt nicht erklären.
- Quelle:
- Marfa
- Alexander Busche
- 05/16 | Evolution. Survival of the fittest (Auszug)
- S. 10-20
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe