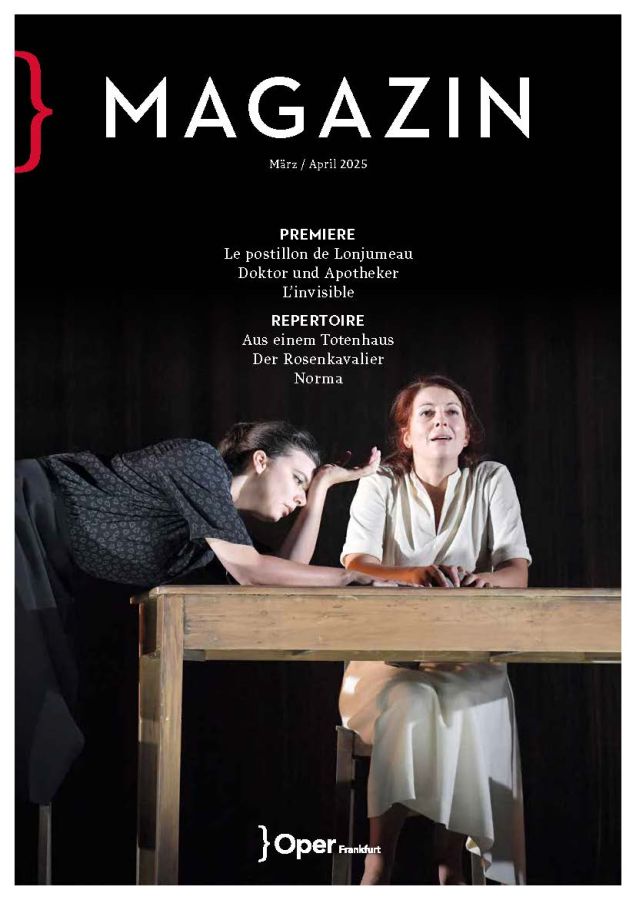Vergebliche Hoffnung?
Text: Maximilian Enderle
In: Magazin, März / April 2025, Oper Frankfurt, S. 18-19 [Publikumszeitschrift]
Aribert Reimann untersucht in seinen Opern immer wieder vermeintlich ausweglose Situationen: Sein Erfolgsstück Lear etwa zeigt einen Herrscher, der alles verliert und zu einer armseligen Kreatur verkommt. In Troades müssen trojanische Frauen nach dem verlorenen Krieg die Flucht antreten. Die als Koproduktion in Wien und Frankfurt uraufgeführte Medea wiederum erzählt von einer Frau, die in der Fremde nicht akzeptiert wird.
In L’invisible entspringt die Ausweglosigkeit nicht einer politischen, sondern einer existenziell-menschlichen Situation: Alle Figuren der Oper sind mit der unüberwindbaren Macht des Todes konfrontiert. Der Überlebenskampf einer Mutter im Kindbett, der Selbstmord einer jungen Frau sowie die heimtückische Ermordung eines jungen Thronfolgers verdichten sich zu einem Panorama der menschlichen Endlichkeit.
Reimann griff für das Libretto auf drei Kurzdramen von Maurice Maeterlinck zurück. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, oszillieren diese zwischen einem bürgerlichen Realismus und einer symbolistischen Vieldeutigkeit. Zugleich spricht aus den lakonisch-poetischen Texten auch Maeterlincks lebenslange Faszination für das Mysterium des Todes, dem er keineswegs nur pessimistisch entgegenblickte. Viel mehr bedauerte der Autor, dass seine Zeitgenossen »die Endlichkeit nicht als Erlösung und das Sterben nicht als Verwandlungsmöglichkeit begriffen«. Maeterlinck hielt den Tod für die einzige Gewissheit, die dem Menschen eine metaphysische Geborgenheit vermitteln kann.
»Das wirst du einmal komponieren!«
Aribert Reimann kam erstmals in den 1980er Jahren mit Maeterlincks Kurzdramen in Berührung, als er an der Berliner Schaubühne eine Aufführung von L’intruse und Intérieur erlebte. Rückblickend beschrieb er diesen Theaterabend als Initialzündung für seine Arbeit an L’invisible: »Damals ging ich aus dem Theater und wusste: Das wirst du einmal komponieren!« Während der Arbeit am Libretto zwischen 2011 und 2016 stieß der Komponist auf La mort de Tintagiles, das er daraufhin als Schlussstück von L’invisible verwendete.
Die einzelnen Teile der Oper verwob Reimann zu einem sogartigen Ganzen: Durch Doppelbesetzungen sind gleich mehrere Sänger*innen in allen drei Stücken präsent. So wird etwa der Großvater aus L’intruse zum Alten in Intérieur und zum Mentor Aglovale in La mort de Tintagiles. Auch die Rollen der Ursule, Marie und Ygraine sind allesamt mit derselben Koloratursopranistin besetzt. Eine weitere wichtige Scharnierfunktion innerhalb des Werkes kommt den drei Countertenören zu: Anfangs reflektieren sie zwischen den jeweiligen Stücken das Geschehen, wofür Reimann Gedichte aus Maeterlincks Band Serres chaudes adaptierte. Im letzten Teil, der einem düsteren Kunstmärchen gleicht, greifen sie schließlich in die Handlung ein und führen als Dienerinnen der Königin den Mord am jungen Tintagiles aus.
Komplementäre Farben
Auch musikalisch sind die drei Teile der Oper durch eine komplementäre Instrumentation eng miteinander verbunden. Während eingangs in L’intruse lediglich die Streicher mit perkussiven und clusterartigen Klängen zu hören sind, kommen in Intérieur nur die Holzbläser vor. Erst im abschließenden La mort de Tintagiles spielt das Orchester, ergänzt um ausgewählte Schlaginstrumente, im Tutti.
Wie alle Opern von Aribert Reimann überzeugt auch L’invisible durch einen hoch expressiven Einsatz der Gesangsstimmen: Die Todesangst der Figuren spiegelt sich wahlweise in abgehackten, kurzatmigen Phrasen oder in bedrohlich wuchernden Koloraturballungen. Den maximalen Kontrast zu dieser vokalen Opulenz bildet die Figur des Tintagiles, der als Sprechrolle für einen Knaben angelegt ist. Wenn Tintagiles redet, hält das Orchester inne und die Zeit scheint stillzustehen. Umso näher geht uns das Schicksal des Jungen, dessen Leben viel zu früh ein Ende findet.
Todesschatten
Reimann sah in Tintagiles’ Schicksal womöglich eine Verbindung zu seiner eigenen Biografie. Sein älterer Bruder Dietrich, dem die Oper L’invisible gewidmet ist, starb im Alter von 13 Jahren bei einem Bombenangriff auf Berlin. »Der Schatten des Todes ist deshalb seit meinem achten Lebensjahr an meiner Seite«, kommentierte Reimann rückblickend diese Erfahrung.
In seiner Partitur stellt der Komponist neben den Schattenseiten des Todes aber auch dessen Gegenkräfte dar. So werde die Musik »gerade dadurch lebendig, dass sie das Verhängnis des Todes aufhalten möchte«. Denselben Wunsch hegen im letzten Teil der Oper auch die Charaktere Ygraine, Aglovale und Bellangère: Obwohl bereits mehrere ihrer männlichen Familienmitglieder getötet wurden, versuchen sie Tintagiles vor seiner mörderisch-machthungrigen Großmutter zu beschützen. Ihre Bemühungen bleiben zwar vergebens, doch liegt gerade in ihrem Aufbegehren ein Moment der Hoffnung und Selbstbestimmung.
Aribert Reimann verfolgte nach der Berliner Uraufführung von L’invisible 2017 den Plan, eine weitere große Oper zu schreiben. Bis zuletzt arbeitete er an diesem Projekt, musste sich aber schließlich im Frühjahr 2024 einer tödlichen Krankheit geschlagen geben. Und so blieb seine »trilogie lyrique« nach Maurice Maeterlinck nicht nur eine sehr persönliche, sondern auch Reimanns letzte vollendete Oper.