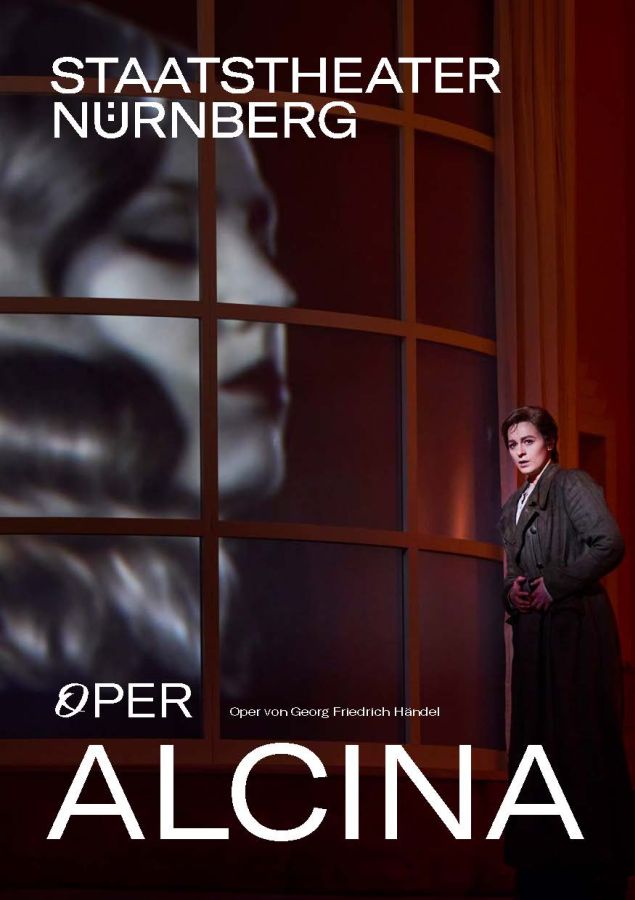- Alcina
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Georg Friedrich Händel, Saison 2024/25
- S. 24-31
Stillstand im Schlaraffenland
Text: Georg Holzer
In: Alcina, Oper von Georg Friedrich Händel, Saison 2024/25, Staatstheater Nürnberg, S. 24-31 [Programmheft]
Ludovico Ariosto aus Ferrara in der Po-Ebene schrieb einen großen Ritterroman, als es längst keine Ritter mehr gab. Sein „Orlando furioso“ („Der rasende Roland“) war, als er in vollständiger Ausgabe 1532 erschien, eine Verbeugung vor einer guten alten Zeit, aber auch ein großer Spaß: Hier flogen Ritter sogar zum Mond, um dort die verloren gegangene Vernunft des verrückten Orlando in einer Flasche zurück zur Erde zu bringen. Ariosts großes Gedicht ist ein Fest der Fantasie und der Spinnerei, ein Ritterroman und die Parodie eines Ritterromans und die Quelle von unzähligen Opern, die auf die Episoden des „Orlando furioso“ zurückgehen. Vor allem in der Oper überlebten seine Geschichten, die heute wohl selbst in Italien nur noch wenig gelesen werden. Für Händel und seine Zeitgenossen war Ariosts Roman ein unerschöpfliches Handlungs-Reservoir. Hier fanden sie alles, was sie für abwechslungsreiche Opern brauchten: Verwicklungen, Intrigen, Macht, Tragik, Humor und immer wieder Liebe in unterschiedlichsten Konstellationen.
Höhe- und Endpunkte
Als Händel 1735 „Alcina“ komponierte, hatte er fast 25 Jahre in London gelebt und gearbeitet, war Englands bekanntester Komponist (und sollte das 200 Jahre lang bleiben) und war nach vielen Kämpfen, Erfolgen und Reinfällen noch immer voller Ideen und Kraft. Noch kein europäischer Musiker vor ihm hatte sich ohne feste Stelle bei der Kirche oder einem adligen Mäzen als freier Unternehmer eine so herausragende Position geschaffen. Doch der Preis dafür war hoch. Händel war von der Gunst des Publikums abhängig, außerdem von den Sängerstars, die dieses Publikum hören wollte. Das unternehmerische Risiko trug er nicht alleine, aber zu großen Teilen: Wenn ein Stück durchfiel, hatte er es umsonst geschrieben und konnte es höchstens noch für spätere Opern ausschlachten. Ab den 1720er Jahren setzte ihm die Konkurrenz hart zu, sein Erfolgsrezept rief Nachahmer auf den Plan, die mehr investieren konnten und so seine Gewinne abgruben. Zur Entstehungszeit von „Alcina“ gelangte das Erfolgsmodell Händel-Oper an sein Ende. Seine erste Oper für das erst 1732 erbaute Covent Garden Theatre, „Ariodante“, war ein Flop gewesen. Mit „Alcina“ wetzte er diese Scharte aus und lockte noch einmal viel Publikum in den Saal. Doch der Niedergang ließ sich nicht aufhalten. Wenige Jahre versuchte es Händel noch mit weiteren Opern, dann verlegte er sich auf die Komposition geistlicher Oratorien, mit denen er bis zu seinem Tod seinen Lebensunterhalt sicherte und seinen Nachruhm begründete.
Die böse Zauberin
Schade, dass das Londoner Publikum der Händel-Opern zuletzt überdrüssig wurde. Verdient hatten sie das nämlich nicht. Es mag sein, dass Händel kein Komponist war, der sich künstlerisch deutlich weiterentwickelte; eine Arie von 1711 und eine von 1735 unterscheiden sich von ihrer Machart her nicht nennenswert. Als Dramatiker machte er aber durchaus Fortschritte. In „Alcina“ ist die Handlung so stringent und verständlich wie in wenigen Händel-Opern, dazu sind die Rezitative aufs Notwendige reduziert und lassen den Arien den Vortritt. Sicher war Händel immer sehr abhängig von der Qualität seiner Libretti, doch in diesem Fall scheint er sogar selbst am Text Hand angelegt zu haben. Wer das Libretto zu „Alcina“ verfasst hat, ist unbekannt; wir wissen nur, dass es vom Textbuch zu einer anderen Oper inspiriert ist, „L’isola di Alcina“ („Alcinas Insel“) von Riccardo Broschi. Es ist gut möglich, dass Händel sich den Text für seine Komposition selbst eingerichtet hat.
Das Bemerkenswerteste in Händels Oper ist jedoch die Hauptfigur. Figuren-Psychologie ist normalerweise nicht die Stärke der Barockoper. Ihr Personal ist durch festgelegte Typen bestimmt: das hohe Paar, das niedrige(re) Paar, der untreue Liebhaber, die unbeirrbar treue Frau (oder umgekehrt), der gewissenlose Herrscher, der pflichtvergessene Held, das verlassene Kind. Dass eine Figur sich verändert, im Lauf der Handlung einen Weg zurücklegt, ist eher nicht vorgesehen. Alcina aber tut es: Sie beginnt ganz oben, als umschwärmte Frau von sagenhafter Schönheit, als Mittelpunkt einer Party-Gesellschaft, in der sie geliebt und verehrt wird. Doch sie muss dabei zusehen, wie sie Stück für Stück abgebaut wird, wie ihre Macht und ihre Verführungskraft schwinden. Sie kämpft um ihren Geliebten und ihre Position, letztlich ohne Erfolg: Am Ende hat sie alles verloren, alle verlassen sie, ihre Welt liegt in Trümmern. Was sie erschaffen hat, ist nichts mehr wert. Sie stirbt einen sozialen Tod, bleibt alleine und missachtet zurück.
Kann sein, dass sie daran nicht ganz unschuldig ist. Ihr Umgang mit abgelegten Liebhabern ist moralisch nicht über jeden Zweifel erhaben, und auch Zauberei – nur ein edleres Wort für Lüge, Verstellung und Machtmissbrauch – ist nicht gut angesehen. Doch der Zorn und die Selbstgerechtigkeit der anderen treffen sie unvorbereitet. Hat sie nicht für alle das Beste gewollt? Wer loyal zu ihr ist, hat unter ihrer Herrschaft ein schönes Leben. Hat sie Ruggiero nicht ehrlich geliebt? Warum tauscht er sie gegen den als Mann verkleideten Trampel Bradamante ein, eine Frau, die nicht eleganter ist als ihr Name? Warum will dieser Trottel lieber zurück in den Krieg, als mit ihr ein süßes Leben zu führen?
Grüne Wiesen
Nach den Regeln der Barockoper verläuft Ruggieros Gang durch die Handlung in einer geraden Linie. Er ist von Alcina verzaubert, verführt von ihrer Schönheit, ihrer Liebe zu ihm und dem guten Leben bei ihr. Dass ihn der vermeintliche Ricciardo, der in Wahrheit Bradamante ist, zu seiner Verlobten zurückbringen will, lehnt er ab, doch ruft ihn schließlich Melisso in Gestalt seines alten Lehrers Atlante zur Ordnung. Nun verliert Alcinas Zauber seine Kraft, er besinnt sich auf seine Pflicht und bereitet die Flucht vor.
Doch ist Ruggiero keineswegs der Held auf Abwegen, dem eine nachdrückliche Erinnerung an seine wahren Aufgaben genügt, um wieder auf die Spur zu kommen. Er hat schwer mit sich zu ringen und ist sich gar nicht sicher, ob er wieder in sein altes Leben zurück will. Die erdverbundene Bradamante macht gegen die majestätische Alcina keine gute Figur, und die Annehmlichkeiten eines Luxuslebens tauscht er sicher nicht leichtfertig gegen die Strapazen einer Soldatenexistenz ein. Der Wendepunkt für Ruggiero ist nicht Melissos Strafpredigt, auch wenn die ihre Wirkung nicht verfehlt. Seine Zerrissenheit drückt er in der Arie „Verdi prati“ („Grüne Wiesen“) aus, die der Angelpunkt nicht nur der Figur, sondern des ganzen Stücks ist. Er betrachtet seine Umgebung, die Alcinas Werk ist, und stellt fest, dass sie durch seine Flucht gemeinsam mit ihrer Schöpferin untergehen wird. Händel hätte daraus ein Triumphlied machen und Ruggieros Sieg über die Zauberin und die Zauberei feiern können. Aber er tut das Gegenteil. Er komponiert ein Larghetto, einen langsamen Trauergesang, voll von der Melancholie des Abschieds von einer schönen, allzu schönen Welt: „Ihr grünen Wiesen, idyllischen Wälder werdet eure Schönheit verlieren. Ihr hübschen Blumen, rauschenden Bäche werdet eure Anmut verändern. Alles Schöne wird in den Schrecken seines vorigen Zustands zurückversetzt.“ Hier ist keine Häme zu hören, nur große Traurigkeit über den Untergang einer perfekten Welt.
Soldaten wohnen auf den Kanonen
So ist die Oper „Alcina“ eine Variation des Mythos vom Schlaraffenland: ein Ort, der zu schön ist, um wahr zu sein. Ruggieros Wahrheit ist anderswo, beim Militär, in der überraschungslosen, beständigen und auf Reproduktion orientierten Beziehung zu Bradamante. Soldaten wohnen eben nicht im Paradies, sondern auf den Kanonen. Es scheint, als ahne Ruggiero, dass im süßen Leben seine Auslöschung als Individuum lauert, die Bedeutungslosigkeit, die er mehr fürchtet als alle Strapazen und sogar als den Tod. Ein Leben mit Alcina bedeutet für Ruggiero alle möglichen Annehmlichkeiten, aber auch den Stillstand. Welche Ziele soll man noch haben, wenn alles stimmt? Und was ist ein Mensch ohne Ziele?
Das spüren auch die Figuren, die es in Alcinas Fahrwasser eigentlich gut getroffen haben. Der kleine Oberto wird von ihr verwöhnt, aber er kann seinen Vater nicht vergessen, den Alcina auf dem Gewissen hat. Alcinas Schwester Morgana hätte alles, was sie will, aber das Leben im Schatten der großen Schwester und mit einem schwachen Mann an ihrer Seite reizt sie nicht mehr. Alcina verliert ihre Attraktivität, nicht als Frau, sondern als Lebensform. Der Untergang ihres Reichs der Schönheit, der Verfeinerung, der Erotik und des Genusses ist zwangs läufig und zugleich sehr traurig. Es erinnert an die Verse, die Heimito von Doderer über die Wiener Strudlhofstiege schrieb: „Viel ist hingesunken uns zur Trauer,/ Und das Schöne zeigt die kleinste Dauer.“
- Quelle:
- Alcina
- Staatstheater Nürnberg
- Oper von Georg Friedrich Händel, Saison 2024/25
- S. 24-31
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe