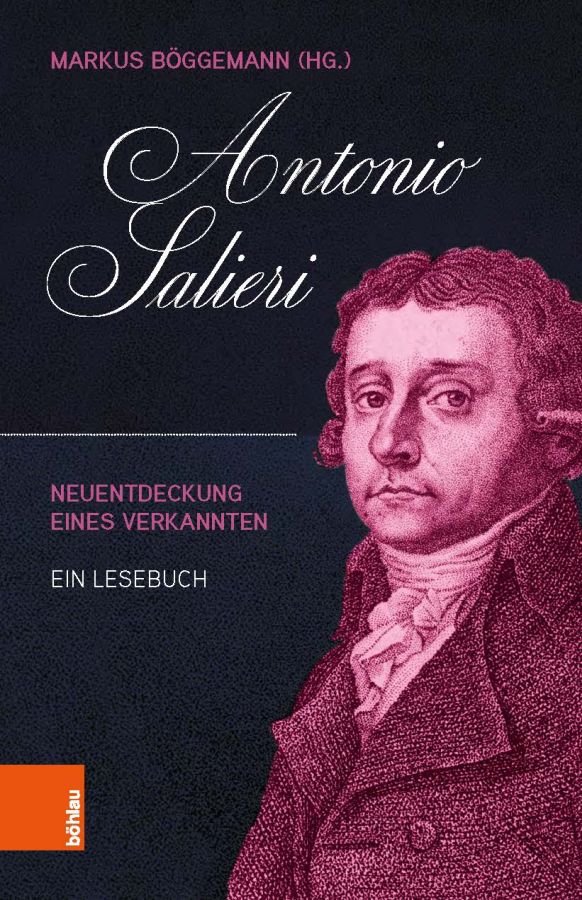- Antonio Salieri
- Böhlau Verlag
- Neuentdeckung eines Verkannten. Herausgegeben von Markus Böggemann, 2025 (Auszug)
- S. 103-119
Salieri als Migrant
Text: Scott L. Edwards
In: Antonio Salieri, Neuentdeckung eines Verkannten. Herausgegeben von Markus Böggemann, 2025 (Auszug), Böhlau Verlag, S. 103-119 [Buch]
Wie mag es für den 15-jährigen Antonio Salieri gewesen sein, nach seiner langen Reise von Venedig am 15. Juni 1766 in Wien anzukommen? Vermutlich war er von den breiten Straßen, den offenen Plätzen und der imposanten Architektur Wiens unmittelbar beeindruckt, denn sie bildeten einen starken Kontrast zu den engen Gassen voll lebhaften Treibens in der Hafen- und Handelsstadt Venedig. Die Wohnung seines Mentors, des Hofkapellmeisters Florian Leopold Gassmann, der ihn zunächst bei sich aufnahm, lag nicht weit vom Kärntnertortheater entfernt, das durch den kurz zuvor erfolgten Ausbau zu einer der fortschrittlichsten Bühnen der Zeit geworden war. Salieri hatte wenig Gelegenheit sich einzugewöhnen, denn bereits am Tag nach seiner Ankunft brachte ihn Gassmann in die „italienische Kirche“ und organisierte innerhalb der ersten Woche Besuche von Lehrern für Musik sowie für Deutsch, Französisch, Latein und italienische Dichtung. In dieser ersten Woche in Wien führte Gassmann ihn nicht nur im Hause Pietro Metastasios ein, sondern nahm ihn auch mit zu den Kammerkonzerten, die am Hof für Kaiser Joseph II. veranstaltet wurden.1
Wien war eine Stadt, die Macht und Ordnung ausstrahlte, und Gassmann war bewusst, dass Salieri einer schnellen Einführung in die Förmlichkeiten und die strenge soziale Hierarchie seiner neuen Heimat bedurfte. Die rasche Anpassung, die von Salieri erwartet wurde, und die Menge an Informationen, deren Aufnahme innerhalb kürzester Zeit ihm nicht leicht fiel, werden in einer Geschichte deutlich, die Ignaz von Mosel über Salieris erste Begegnung mit Joseph II. erzählt, bei welcher der Kaiser Salieri fragte, wie ihm Wien gefalle:
Salieri, furchtsam, verlegen, und von seinem Aufenthalt zu Venedig gewohnt, Männer von Rang „Excellenz“ zu tituliren, antwortete: „Gut, Euer Excellenz!“ setzte aber, schnell sich verbessernd, hinzu: „Außerordentlich gut, Euer Majestät!“ – Einige Tonkünstler der Hofkapelle, die eben gegenwärtig waren, lachten über des Jünglings Verlegenheit und Einfalt […].2
Im Folgenden soll untersucht werden, wie Salieris Status als Migrant sein Leben und sein musikalisches Schaffen geprägt hat und inwieweit seine Situation diejenige anderer italienischsprachiger Migrant:innen in Wien widerspiegeln könnte. Im 18. Jahrhundert, einer Zeit vergleichsweise großer politischer Stabilität im Habsburgerreich, erlebte die Stadt ein außergewöhnlich hohes Bevölkerungswachstum: Von etwa 123.500 Einwohner:innen im Jahr 1700 stieg deren Zahl durch mehrere Migrationswellen auf fast 300.000 im Jahr 1800 an.3 Die Musikgeschichtsschreibung beschäftigt sich schon seit langem mit den in Italien geborenen Musiker:innen, die in Wiener Theatern sangen oder in der Hofkapelle spielten. Diese Musiker:innen bildeten jedoch nur eine von mehreren Berufsgruppen in Wien, in denen italienischsprachige Migrant:innen eine wichtige Rolle spielten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren die meisten der italienischsprachigen Eingewanderten am Hof beschäftigt, während später vor allem italienische Handwerker nach Wien migrierten. Umfasste die italienischsprachige Gemeinschaft um 1700 schätzungsweise 2000 Personen, so hatte sich diese Zahl bis 1783 auf etwa 7000 mehr als verdreifacht.4
Salieris Ankunft war somit Teil eines größeren Zuzugs von italienischsprachigen Migrant:innen, die eine Vielzahl von Kenntnissen und Erfahrungen mitbrachten. Ihre verschiedenen Hintergründe und Fähigkeiten waren entscheidend für ihre Integration und erforderten gleichzeitig unterschiedliche Integrationsstrategien. Inwieweit war Salieri in eine größere Gemeinschaft von italienischsprachigen Migrant:innen eingebettet? Welche institutionelle Unterstützung suchte er? Wie war das Verhältnis zu seiner Heimat? Mit welchen Einschränkungen sah er sich konfrontiert und wie fand er sich in der sprachlichen Landschaft Wiens zurecht? Inwieweit verstand er sich selbst als Immigrant oder als jemand mit einer ‚multilokalen Identität‘? Kurz gesagt: Wie nah können wir einem Verständnis davon kommen, was es für Salieri wirklich bedeutet hat, als Immigrant in Wien zu leben?
Die Antworten auf diese Fragen fallen für zugewanderte Personen individuell sehr unterschiedlich aus, und das Beispiel Antonio Salieri ist in vielerlei Hinsicht einzigartig genug, um ihn von seinen Zeitgenossen abzuheben. Sein 1764 verstorbener Vater war in Legnago in der Provinz Verona ein wohlhabender Kaufmann gewesen, und es war ein Freund des Vaters, der venezianische Adlige Giovanni Mocenigo, der es dem Waisenkind Antonio ermöglichte, seine musikalischen Studien nach dem Tod der Eltern fortzusetzen. Dank dieser Unterstützung kam er in Venedig mit Gassmann in Kontakt, und nach der gemeinsamen Ankunft in Wien sorgte Gassmann dafür, dass Salieri jegliche Förderung erhielt, die er für eine erfolgreiche musikalische Karriere benötigte. Der Unterricht in Deutsch, Französisch und Latein half ihm, sich in aristokratischen und höfischen Kreisen angemessen zu bewegen. Indem Gassmann Salieri wöchentlich in das Haus brachte, das von den Familien der Komponistin Marianna Martines und des Hofdichters Metastasio gemeinsam bewohnt wurde, sorgte er gleichzeitig dafür, dass der junge Komponist Zugang zu gebildeten italienischen Kreisen erhielt und sein Gespür für italienische Dichtung verfeinern konnte.
Integration
Dank der Förderung durch Gassmann war Salieri zunächst weniger als andere Migrant:innen auf städtische Institutionen und Netzwerke angewiesen. Gleich zu Beginn jedoch kam er in Kontakt mit einem städtischen Netzwerk, das sein Leben lang einen prägenden Einfluss auf ihn ausüben sollte: das der „italienischen Kirche“. Wie Mosel berichtet, brachte Gassmann Salieri am Tag nach seiner Ankunft zu dieser Institution, „um dort der Andacht zu pflegen.“5 Salieri erzählt von diesem Ereignis nicht nur, um die Stärke seines Glaubens zu bekräftigen oder Gassmanns Großzügigkeit als Vormund hervorzuheben, sondern auch, um zu betonen, welche Bedeutung diese Kirche während seines gesamten Lebens in Wien hatte.
Es ist unklar, welche Institution Salieri mit „italienische Kirche“ meint, da es in den ersten zwei Jahrzehnten nach seinem Umzug nach Wien dort mehr als ein Gotteshaus für die italienischsprachige Gemeinde gab. Möglicherweise bezieht er sich auf die Kapelle, die einst am Ballhausplatz neben der Minoritenkirche stand; diese war bekannt als Katharinenkapelle, wurde aber umgangssprachlich auch als „italienische Kirche“ bezeichnet, da sie ursprünglich der Bruderschaft des Heiligen Franz von Assisi als Gebetsstätte diente.6 Ebenso könnte Salieri in ein Oratorium im Professhaus der Jesuiten an der Ecke Bognergasse/Seitzergasse gebracht worden sein, das von den Wienern oft als „Welsche Kapelle“ bezeichnet wurde. Bis zum Jahr 1773 zelebrierte dort die Congregazione Italiana, eine Bruderschaft italienischsprachiger Bewohner der Stadt, ihre Messen auf Italienisch.7 Nachdem diese Kapelle 1773 auf Betreiben des Kaiserhofs requiriert worden war, fand die Kongregation ein neues Zuhause in der erwähnten Katharinenkapelle und begann umgehend mit deren Restaurierung. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgte am 1. Februar 1775 die feierliche Einweihung unter dem Namen „Madonna della Neve“ mit einer Festmesse, die von Salieri geleitet wurde.
Im Jahr 1781 schloss sich der Congregazione Italiana eine weitere Institution an, die Confraternità del Sovvegno. Diese war 1690 von italienischsprachigen Seidenweber:innen gegründet worden und diente der Unterstützung armer und kranker Mitglieder.8 Somit vereinten die beiden Institutionen ein breites soziales Spektrum der italienischsprachigen Bevölkerung: Die Bruderschaft, die größtenteils aus Handwerker:innen bestand, verband sich mit dem Adel und dem wohlhabenden Bürgertum, die mehrheitlich die Kongregation ausmachten. In Anbetracht der stark gewachsenenen Mitgliederzahl übergab Joseph II. der erweiterten Congregazione Italiana die Minoritenkirche mit dem Auftrag, die Kirche für die kollektiven Bedürfnisse der damals etwa 7000 in Wien lebenden italienischsprachigen Bewohner:innen zu restaurieren.
Salieri blieb sein Leben lang intensiv in die Aktivitäten der Kongregation eingebunden, sei es musikalisch, sozial oder spirituell. Er trat dort häufig als Dirigent auf, wurde in ihre Verwaltungsorgane berufen und pflegte dauerhaft gesellschaftliche Verbindungen zur italienischen Oberschicht, da die Kirche auch Sitz des örtlichen Nuntius war. Am 16. Juni 1816 feierte er in der Kirche den 50. Jahrestag seiner Ankunft in Wien mit Dank für sein glückliches Leben, und im selben Jahr verfasste er sein Testament, in dem er die Abhaltung von 24 Messen in der italienischen Kirche sowie seine Beisetzung ohne Pomp und größere Zeremonien verfügte. Ungeachtet dieses Wunsches wurde nach seinem Tod am 7. Mai 1825 sein eigenes Requiem am 22. Juni 1825 in einem feierlichen Seelenamt zu seinen Ehren in der italienischen Kirche aufgeführt.
Die Wahrnehmung von Salieri weniger als Immigrant denn als vollständig integrierter Bürger in Wien wurde durch seine Beteiligung an einer Reihe weiterer Institutionen (darunter die Tonkünstler-Societät zugunsten der Witwen und Waisen von Musikern), seine Position als Oberleiter der Wiener Singschule und seine aktive Mitwirkung bei der Gründung des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde befördert. Mit seinem Engagement in diesen Institutionen konnte er der Stadt, der er seinen Erfolg verdankte, etwas zurückgeben, während er gleichzeitig den Grundstein für wohltätige Arbeit und musikalische Ausbildungsmöglichkeiten legte. Des Weiteren dirigierte Salieri zahlreiche Wohltätigkeitskonzerte zugunsten der Tonkünstler-Societät im Burgtheater sowie Konzerte in der Augustinerkirche, im Universitätssaal, in der Kirche des Invalidenhauses und im Stephansdom, wo er an Sonntagnachmittagen, „so oft ich konnte“, Gottesdienste besuchte; auf diese Weise kamen auch Stadtbewohner:innen außerhalb des Hofes mit seiner Musik in Berührung.9
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Integration waren sowohl die Einbürgerung als auch der Eintrag in die lokalen Heiratsregister, ein Schritt, den Salieri dank seiner Tätigkeit als Musiklehrer im Nonnenkloster St. Laurenz zügig bewältigte.10 Seine Ernennung zum Kammerkomponisten am Hof im Jahr 1774 ermöglichte ihm eine Heirat, und bereits am ersten Tag seines Unterrichts in St. Laurenz im Jahr 1775 traf er auf Theresia Helferstorfer, seine zukünftige Frau, die er nach einem der Sonntagsgottesdienste im Stephansdom zunächst auf Französisch ansprach. Der Ehevertrag wurde am 10. Oktober 1775 geschlossen.11 Die scheinbare Leichtigkeit, mit der Salieri diese Ziele erreichte, stand in starkem Gegensatz zur Situation vieler anderer Migrant:innen, deren Weg zur Einbürgerung nicht immer reibungslos verlief. Frühneuzeitliche Städte betrachteten die Vergabe des Bürgerrechts als das wichtigste Instrument ihrer Einwanderungspolitik, wobei ‚wünschenswerte‘ Ausländer:innen integriert und solche, die als „schädlich“ angesehen wurden, ausgeschlossen werden sollten.12 Salieris katholische Frömmigkeit, seine Stellung am Hof und seine Einbindung in lokale Institutionen sorgten dafür, dass ihm kaum Hindernisse im Weg standen.
Die Unterstützung durch familiäre Netzwerke stellt für Migrant:innen eine wesentliche Quelle wirtschaftlicher wie auch emotionaler Stabilität dar. Wenngleich Salieri als Waise nach Wien kam, pflegte er weiterhin Kontakt zu den noch lebenden Familienmitgliedern in seiner Heimat. Die Intensität dieser Verbindung lässt sich aufgrund des Fehlens privater Briefe schwer beurteilen, aber die Geldbeträge, die Salieri der Familie seines Bruders Francesco Antonio, Organist an der Kirche San Martino in Legnago, sowie zwei seiner Neffen, die beide als Musiker tätig waren, vermachte, deuten darauf hin, dass diese Beziehungen für den Komponisten weiterhin von Bedeutung waren. Darüber hinaus ist dokumentiert, dass Salieris Bruder Pietro, Mitglied des Minoritenklosters in Padua, 1777 und 1781 Predigten in der Katharinenkapelle hielt und wohl als Bindeglied zur Heimat fungierte.13
Die meisten italienischsprachigen Einwohner:innen Wiens lebten innerhalb der Stadtmauern in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander und bewahrten dadurch ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Viele hatten ihre Wohnstätten rund um das Widmerviertel und die großen Marktplätze, wo zahlreiche italienischsprachige Händler:innen und Kaufleute ansässig waren.14 Solange er in Gassmanns Haushalt lebte, zog Salieri mehrmals um, ließ sich aber 1772 ebenfalls im Widmerviertel nieder. In diesem Viertel verbrachte er sein ganzes weiteres Leben. Bei seinen täglichen Spaziergängen entlang der Stadtmauer muss er die beruhigenden Routinen seiner privaten und beruflichen Existenz verspürt und sich in seiner Welt, die von der Pracht der Stadt und des Hofes geprägt war, wohlgefühlt haben.
Sprache
Das umgehende Engagement von Lehrern für Französisch, Latein, Deutsch und italienische Dichtung hatte nicht nur zum Ziel, Salieri mit den sprachlichen Fähigkeiten auszustatten, die er am Hof benötigte, oder ihm die Sprachen zu vermitteln, die für das Komponieren erforderlich waren. Der Sprachunterricht war auch wesentlich für seine Integration und Einbürgerung. Die genannten Sprachen eröffneten ihm den Zugang zur Welt der Diplomatie, des Adels, der Kirche und der Bildung, während sie ihm gleichzeitig eine Reihe sprachlicher Strategien an die Hand gaben, die ihm halfen, sich in der vielsprachigen Stadt Wien zurechtzufinden. Im Laufe der Jahre entwickelte Salieri eine Technik des sprachlichen Code-Switchings, wobei er sich im Interesse eines zweckmäßigen Ausdrucks frei einer beliebigen Sprache bediente, zuweilen in mehr als einem Register.
Salieris Sprechweise lässt sich aus Anekdoten derjenigen erahnen, die ihm begegnet sind. Mosel schreibt, dass Salieri die Angewohnheit hatte, in ein und demselben Gespräch Französisch, Deutsch und Italienisch zu mischen, eine Sprachmixtur, die von manchen als verwirrend empfunden wurde. Als der schwäbische Theologe Siegfried Wiser Salieri 1783 begegnete, schrieb er: „Aber wie kan ich sein deütsch=französisch=italiänisch Stammeln – seiner ersten Freüde – et de sa gratitude – et dal suo trasporto beschreiben?“15 Hier deutet Wiser an, wie Salieris Deutsch in höflichen Ausdrücken dem Französischen wich, er aber, wenn er von Emotionen überwältigt wurde, auf seine Muttersprache Italienisch zurückgriff. Diese sprachliche Strategie setzte sich bis in seine letzten Lebensjahre fort. Auch Friedrich Rochlitz war während einer Begegnung im Frühjahr 1822 von Salieris unkonventioneller Sprechweise überrascht: „Dazu nun diese Sprache! Wenn ihm, im Feuer der Rede das Deutsch ausging, kam Italienisch, mitunter auch Französisch; worüber er sich lächelnd entschuldigte: ‚Ich bin erst über funfzig Jahre in Deutschland: wie hätt’ ich da schon die Sprache lernen können!‘“16
Salieris limitierte Deutschkenntnisse reduzierten seine Chancen auf Kompositionsaufträge, insbesondere in seinen späteren Lebensjahren, als die italienischsprachige Musik in Wien ihre Vorrangstellung verlor. Die sprachliche Barriere weckte selbst bei seinen Bewunderern Zweifel, wie etwa dem sächsischen Juristen Christian Gottfried Körner, der den Komponisten seinem Freund Friedrich Schiller nicht uneingeschränkt empfehlen mochte: „Wenn Du noch einmal zu den Malthesern einen Componisten brauchst, so würde ich Haydn vorschlagen; freilich Salieri noch lieber, wenn er deutsch versteht.“17 Ähnlich äußerte sich der Schriftsteller und Diplomat Georg August Griesinger gegenüber Breitkopf & Härtel und schlug vor, Salieri den Text für eine italienische Kantate zu geben, wobei er hinzufügte: „In der deutschen Sprache ist er auch nicht sonderlich bewandert.“18
Salieris eigene Überlegungen verdeutlichen seine Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, insbesondere in schriftlicher Form, und die Probleme beim Navigieren zwischen Italienisch und Deutsch im Kontext der musikalischen Übersetzung erschwerten die Lage noch. In einem Brief von 1783 an Carl Friedrich Cramer gibt Salieri zu, dass er „unerfahren nicht nur im Sprechen der deutschen Sprache, sondern noch mehr im Lesen derselben in ihren nationalen Schriftzeichen [d. h. in der deutschen Kurrentschrift]“ sei.19 Des Weiteren äußert er sich höchst unzufrieden über die Übersetzung seiner Werke ins Deutsche, insbesondere mit Blick auf die Schwierigkeiten, die durch Unterschiede in den Strukturen der beiden Sprachen entstehen. Salieri berichtet von einer gescheiterten Zusammenarbeit, bei der ein deutscher Dichter versuchte, seine Oper Daliso e Delmita zu übersetzen. Wenngleich die Übersetzung das italienische Metrum und den emotionalen Gehalt beibehielt, resultierten die erzwungenen Veränderungen der Wortstellung und Reimform in Unbeholfenheiten sowohl in den Vokal- als auch in den Instrumentalstimmen, sodass Salieri das Ergebnis als unfreiwillig komisch empfand. Die Unzufriedenheit mit der Übersetzung führte dazu, dass er eine starke Abneigung gegen deutsche Adaptionen entwickelte, ein Gefühl, das er in besagtem Brief zum Ausdruck brachte: „Ich fasste eine solche Antipathie gegen jede Art von Übersetzung in der Musik, dass ich nicht davon hören konnte, ohne mich zu ärgern.“20
Der Rauchfangkehrer
Nach der Gründung eines Singspiel-Unternehmens durch Joseph II. im Jahr 1778, der Auflösung der Opera-buffa-Truppe und einer zweijährigen Italienreise des Komponisten erhielt Salieri vom Kaiser einen neuartigen Auftrag, der seine sprachlichen Fähigkeiten auf die Probe stellen sollte: die Komposition eines deutschen Singspiels. Salieri protestierte beim Kaiser, dass er aufgrund seiner schlechten Deutschkenntnisse nicht wisse, wie er eine solche Aufgabe angehen solle, aber Joseph II. ermutigte ihn, sie als „Sprach-Uebung“ zu betrachten.21
Das Ergebnis dieser Übung war das Singspiel Der Rauchfangkehrer von 1781, Salieris erstes Bühnenwerk in deutscher Sprache. Der Librettist Leopold Auenbrugger, ein steirischer Arzt, stand Salieri sehr nahe, da er als Trauzeuge bei dessen Hochzeit fungiert hatte und seine beiden Töchter, Marianne und Franziska, Schülerinnen von Salieri waren. Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit war ein Singspiel, dessen Titelfigur wahrscheinlich nach dem Vorbild von Salieri selbst gestaltet wurde; indem sie eine Geschichte schufen, mit der sich der Komponist identifizieren konnte, wurde Salieris erster Ausflug in das Genre des Singspiels mit lebendiger Authentizität auf die Bühne gebracht.
Der italienische Schornsteinfeger Volpino und die Köchin Lisel sind heimlich verlobt, während zwei Adlige, Bär und Wolf, die wohlhabende Witwe Frau von Habicht und deren Stieftochter Fräulein Nannette heiraten möchten, die beide Musikliebhaberinnen sind. Um die Zuneigung der Frauen zu gewinnen, entwickelt Volpino einen Plan: Er will die beiden mit seinem musikalischen Talent beeindrucken und sich durch eine raffinierte Täuschung eine Mitgift für die Ehe mit Lisel sichern. Wie zufällig hören ihn die beiden Frauen am Klavier ein italienisches Lied singen, und als er ihre Aufmerksamkeit erregt hat, erzählt er ihnen, er sei der Marchese d’Intrighi, der nach einem Mord beim Pharo-Spiel aus Italien habe fliehen müssen und nun als Schornsteinfeger getarnt reise. Die beiden Frauen bitten ihn, ihr Gesangs- und Italienischlehrer zu werden, was die Inszenierung der privaten Musikstunden auf der Bühne ermöglicht.
Mit vier italienischen Arien, die in das deutsche Libretto eingefügt wurden, und einem Protagonisten, dessen Deutsch durch italienische Einschübe und grammatikalische Fehler gefärbt ist, erkannte Salieri zweifellos ein Abbild seiner selbst auf der Bühne. Auenbruggers Darstellung von Volpinos Gesangsunterricht war wahrscheinlich unmittelbar von Erfahrungen mit dem Unterricht, den seine Töchter bei Salieri erhielten, inspiriert. Darüber hinaus spiegelte die Entscheidung, Volpino als Schornsteinfeger darzustellen, einen Aspekt der breiteren gesellschaftlichen Realität wider: Die Vorliebe für italienische Architektur führte zu einer Dominanz italienischer Schornsteinfeger, da diese mit der Bauweise von Schornsteinen im italienischen Stil vertraut waren.22 Volpino verkörperte somit zwei italienisch dominierte Berufsfelder zugleich, deren entgegengesetzte soziale Welten in ihrem Aufeinandertreffen die Komik der Handlung befeuern.
Die Texte der vier italienischen Arien dienen dazu, den Handlungsverlauf zu kommentieren und seinen emotionalen Gehalt zu verstärken, was – in Verbindung mit den gesprochenen Italianismen, die in Der Rauchfangkehrer durchweg vorkommen – impliziert, dass ihre Bedeutung von vielen im Wiener Publikum verstanden worden sein muss. Volpinos erste Arie, „Augelletti che intorno cantate“, mit der er Frau von Habicht und Nannette ködern will, bringt ebendiese Intention zum Ausdruck, während die zweite Arie den inneren Aufruhr Volpinos offenbart, der sich zwischen zwei Objekten der Zuneigung gefangen fühlt. Diese Arie, „Questo core sta per voi“, hatte für Salieri tiefgehende persönliche Bedeutung, da der Text von Gassmann in dessen Oper Il viaggiatore ridicolo vertont worden war, die am 26. Oktober 1766, kurz nach Salieris Ankunft in Wien, uraufgeführt wurde. Die Einbindung der Arie als ein gewissermaßen eigenständiges Stück im Singspiel erinnert deutlich an die Einlagearien, mit deren Komposition Salieri in seiner Lehrzeit bei Gassmann beauftragt wurde, und unterstreicht so eine persönliche wie auch professionelle Verbindung zum Erbe seines Mentors.
Gleichermaßen autobiographisch gefärbt sind die Musikstunden mit Frau von Habicht und Nannette, die beide Texte von Metastasio singen. Die Rolle der Nannette wurde darüber hinaus für eine von Salieris bekanntesten Schülerinnen, die in Wien geborene Caterina Cavalieri, geschrieben. In beiden Arien unterbricht Volpino die Sängerinnen, um ihre italienische Aussprache zu korrigieren, insbesondere bei der eigensinnigeren Frau von Habicht, die bis zum Schluss mit dem Italienischen kämpft. Während diese Korrekturen im Libretto lediglich als Bühnenanweisungen erwähnt werden, hat Salieri sie explizit auskomponiert. Wahrscheinlich haben sich sowohl Auenbrugger als auch Salieri auf die Unterrichtserfahrungen des Komponisten gestützt, um die beiden Szenen zu entwerfen.
Im ersten Akt erklären Frau von Habicht und Nannette ihren Wunsch nach Italienisch- und Gesangsunterricht mit der Feststellung, dass Deutsch und Französisch für das Singen ungeeignet seien, während Italienisch aufgrund seiner inhärenten Musikalität und Klarheit im musikalischen Vortrag überlegen sei. Diese Vorstellungen spiegeln Salieris eigene Überzeugungen wider, wonach es notwendig sei, auf Italienisch zu singen, um überhaupt gut singen zu können. In seiner Scuola di Canto, einem Manuskript, das er für die Singschule der Gesellschaft der Musikfreunde verfasste, erklärt Salieri: „Es ist bekannt, dass von allen Sprachen Italienisch die günstigste zum Singen ist.“ Er hält außerdem fest, dass der richtige Lehrer „nicht nur von Geburt und Ausbildung Italiener sein muss, sondern auch aus einer Region stammen sollte, in der reines Italienisch gesprochen wird, wobei man, soweit möglich, auf das Sprichwort achten sollte: Lingua toscana in bocca romana [toskanische Zunge/Sprache in römischem Mund]“. Darüber hinaus ermögliche eine solide Grundlage im Italienischen den Sänger:innen auch, später ihre sprachlichen Fähigkeiten auszubauen: „Wer gut auf Italienisch singt, wird auch in anderen Sprachen gut singen können – ich spreche ausschließlich von dem, was den Gesang betrifft.“23 Salieri setzt diese Vorgaben musikalisch um, da, wie er schreibt, die Aussprache besser durch das Singen als durch das Sprechen erlernt werden könne. Der Rauchfangkehrer spiegelt somit Salieris eigene pädagogische Herangehensweise wider, wie sie in der Scuola di Canto skizziert ist: So wie Nannette und Frau von Habicht die italienische Sprache beim Singen zu lernen beginnen, mussten auch Salieris eigene Schülerinnen – ob Cavalieri oder Marianne und Franziska Auenbrugger – beides gleichzeitig erlernen. Durch diesen Prozess der Übertragung wurde Salieris Unterricht lebendig auf die Bühne gebracht.
Lingua franca
Sofern Auenbrugger beabsichtigte, ein Libretto zu verfassen, das Salieris Einstieg in die Welt des Singspiels erleichtern sollte, indem er die sprachlichen Eigenheiten eines italienischen Muttersprachlers einbezog, baute er auf einer gut etablierten Tradition auf, die in vielen Buffo-Opern zu finden ist. Die Vielsprachigkeit war aufgrund ihres kreativen Potenzials ein wirkungsvolles Mittel in der komischen Oper, insbesondere angesichts des ständigen Bedarfs, maskierte Figuren auf die Bühne zu bringen. Ein Beispiel für das komische Potenzial eines mehrsprachigen Librettos, in dem Französisch und Deutsch sowie mehrere italienische Dialekte verwendet werden, war Salieris erster großer Erfolg auf der Wiener Bühne, die Commedia per musica La fiera di Venezia, die 1772 uraufgeführt wurde.
Dennoch besteht ein Unterschied zwischen mehrsprachigem Gesang auf der Bühne und mehrsprachiger Rede im Alltag. Wie Salieri in der Scuola di Canto schreibt: „Abschließend muss man bedenken, dass es eine Sache ist, eine Sprache zu lehren, um einfach Handel zu treiben, und eine ganz andere, sie zu lehren, um sie vor einem Publikum zu verwenden.“24 Der strategische Einsatz von Pidginsprachen in der Handelswelt und im informellen Austausch ist dem multilingualen Sprachgebrauch von Salieri selbst nicht unähnlich. Er muss sich daher besonders an dem kreolisierten italienisch-deutschen Gemisch erfreut haben, das in die Opera buffa Falstaff von 1799 Eingang fand.
In dieser Adaption von William Shakespeares The Merry Wives of Windsor wurde der scena tedesca große Bedeutung zugemessen. Dabei handelt es sich um eine hinzugefügte Szene, die in Shakespeares Vorlage nicht existiert und in der Mistress Ford, eine der beiden „lustigen Weiber“, als vermeintlich Deutsche vor Falstaff erscheint, was zu einem humoristischen Wortwechsel in gebrochenem Italo-Deutsch führt. Ford wurde in der Uraufführung von Irene Tomeoni verkörpert, deren mangelndes Vertrauen in ihre Deutschkenntnisse eine nachträgliche Überarbeitung eines erheblichen Teils des Librettos erforderlich machte, damit eine zweite Szene, in der sie erneut dieses Sprachgemisch hätte vortragen sollen, gestrichen werden konnte.25
Zweifellos war es das gestrichene Terzett, an dem ihr Selbstvertrauen zerbrach. Es sieht nicht nur ein lebhaftes Allegretto vor, sondern hätte von ihr verlangt, schnell zwischen Italienisch und Deutsch zu wechseln, oftmals in rasant vorgetragenen Achteln, die in mehreren Fällen von einem hohen c3 absteigen und sich zu einem dreistimmigen Parlando-Durcheinander steigern.
Das Italienisch, das sie und Falstaff mit Deutsch vermischen, ist eine Pidginversion, in der unkonjugierte Verben im Infinitiv verwendet werden – eine vereinfachte Form, die in Handelskontexten als Lingua franca unter Menschen gebräuchlich war, die über verschiedene Muttersprachen hinweg kommunizieren mussten. Als ein Spiegelbild des polyglotten mündlichen Sprachgebrauchs – und nicht der schriftlichen Übermittlung ‚reiner‘ Sprache – geben die scene tedesche eine gängigere Sprechweise wieder, in der italienische und deutsche Muttersprachler:innen sich trafen, handelten und miteinander verkehrten.
Wie anhand von Falstaff und der Scuola di Canto ersichtlich wird, war Salieri mit den verschiedenen Arten vertraut, in denen Deutsch oder Italienisch als Erst- und als Zweitsprache eingesetzt wurde. Die Einbindung von gemischtsprachigen Szenen in La fiera di Venezia, Der Rauchfangkehrer und Falstaff bildete die vielsprachige, multikulturelle Vielvölkerrealität sowohl des venezianischen als auch des habsburgischen Reichs ab, in denen die politischen Herrschaftsstrukturen verschiedene kulturelle Gruppen zusammenführten, die stark von Migration geprägt waren. Die genannten Bühnenwerke spiegeln die hochgradige Mobilität des Lebens in Wien wider, mit seinen internationalen Netzwerken und der unaufhörlichen Zirkulation von Menschen.
Über Salieris Gedanken zu seiner eigenen Identität kann nur spekuliert werden. In Mosels Biographie findet sich wenig, das eine starke Selbstwahrnehmung Salieris als Venezianer nahelegt – ein Aspekt seiner Identität, der offenbar durch seine rasche kulturelle Anpassung an die höfischen und intellektuellen Kreise Wiens in den Hintergrund trat. Die Jahrzehnte in Wien führten zu einer weitgehenden Integration in das politische und kulturelle Leben der Kaiserstadt, und als Hofkapellmeister stand er im Zentrum des österreichischen Musikbetriebs. Gleichwohl erlebte er in diesen Wiener Jahren bedeutende Umbrüche, sowohl politische Umwälzungen als auch einen Wandel des Musikgeschmacks an der Wende zum 19. Jahrhundert, wobei – wie er bedauernd feststellte – „Uebertreibung und Vermischung der Compositionsgattungen […] an die Stelle einer verständigen und gediegenen Einfachheit“ traten.26 Seine mangelhaften Deutschkenntnisse führten nicht nur zu Einbußen bei Kompositionsaufträgen, sondern befeuerten auch eine posthume Geschichtsschreibung, die ihn ungerechtfertigterweise für eine Abneigung gegen deutsche Dichtung kritisierte. Letztendlich verkörperte Salieri eine kosmopolitische europäische Identität, die den Wandel der Zeiten, in denen er lebte, in sich begriff. Trotz ihrer Einzigartigkeit spiegeln seine Integrationsstrategien in vielerlei Hinsicht die komplexen Identitäten wider, die auch das Leben anderer Migrant:innen, die in dieser Zeit nach Wien kamen, prägten.
Anmerkungen
1 Ignaz von Mosel, Ueber das Leben und die Werke des Anton Salieri, k. k. Hofkapellmeisters, Wien 1827, S. 20–22.
2 Ebd., S. 22.
3 Andreas Weigl, Demographischer Wandel und Modernisierung in Wien, Wien 2000, S. 57–60.
4 Annemarie Steidl, Auf nach Wien! Die Mobilität des mitteleuropäischen Handwerks im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Haupt- und Residenzstadt, Wien/München 2003, S. 67.
5 Mosel, Anton Salieri (wie Anm. 1), S. 20.
6 Manfred Zips, Wo befand sich das erste Gotteshaus der Minoriten in Wien? – Ein verschwundenes Baujuwel nebst der Minoritenkirche, http://www.minoritenkirche-wien.info/daten/lndk-meditation2015-1.htm (letzter Zugriff: 04.12.2024).
7 Giacomo Borioni, Manfred Zips, 1625–2015 / 390 Jahre Italienische Kongregation, http://www.minoritenkirche-wien.info/daten/lndk-meditation2015-2.htm (letzter Zugriff: 04.12.2024).
8 Martin Scheutz, Italiener im Wien des 18. Jahrhunderts. Neubürger, Hofangehörige und hofbefreite Handwerker, in: Römische Historische Mitteilungen 65 (2023), S. 185–230, hier S. 227. Vgl. auch Manfred Zips, Die Minoritenkirche „Maria Schnee“ in Wien. Ihre Geschichte und ihre Kunstdenkmäler, Passau 2012, S. 48.
9 Mosel, Anton Salieri (wie Anm. 1), S. 52.
10 Ebd., S. 51.
11 Michael Lorenz, Antonio Salieri’s Early Years in Vienna, http://michaelorenz.blogspot.com/2013/03/antonio-salieris-early-years-in-vienna.html (letzter Zugriff: 04.12.2024).
12 Scheutz, Italiener (wie Anm. 8), S. 230.
13 Rudolph Angermüller, Antonio Salieri. Dokumente seines Lebens, 3 Bde., Bad Honnef 2000, Bd. 1, S. 110 und S. 172.
14 Marion Dotter, Zwischen Oberitalien und Wien. Die Migration und Transformation italienischer Kaufleute in Wien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Römische Historische Mitteilungen 59 (2017), S. 15–50, hier S. 37.
15 Zitiert nach: Timo Jouko Herrmann, Antonio Salieri und seine deutschsprachigen Werke für das Musiktheater, Leipzig 2015, S. 6.
16 Zitiert nach: Angermüller, Salieri (wie Anm. 13), Bd. 3, S. 335.
- Quelle:
- Antonio Salieri
- Böhlau Verlag
- Neuentdeckung eines Verkannten. Herausgegeben von Markus Böggemann, 2025 (Auszug)
- S. 103-119
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe