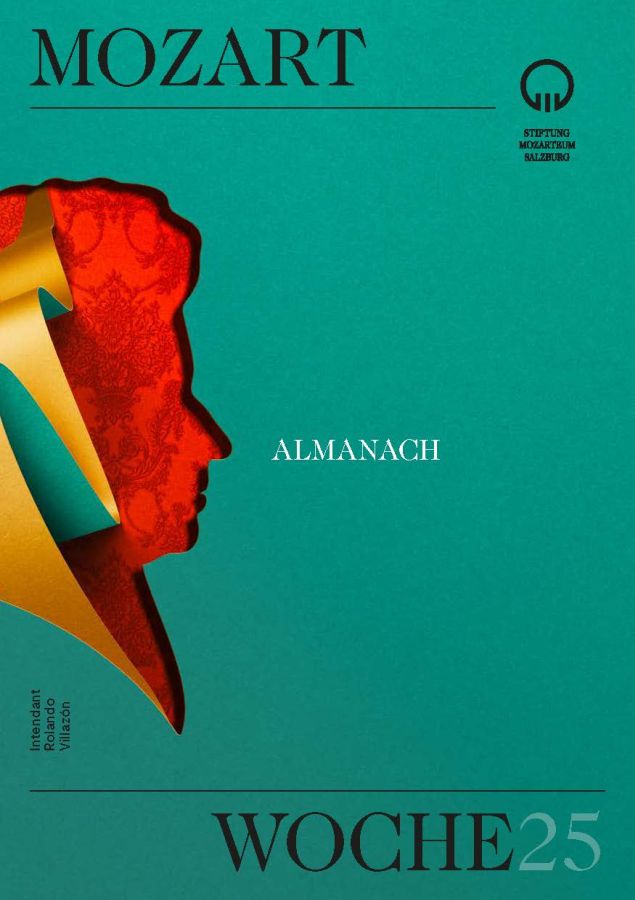- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 70-75
Zum Werk
Text: Christoph Großpietsch
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 70-75 [Programmheft]
JOHANN SEBASTIAN BACH
Kantate Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211 Kaffeekantate
Des Wieners liebstes Getränk ist der Kaffee – manch einer denkt wohl nicht darüber nach, dass sich die Kaffeemode in ganz Europa ausbreiten konnte, nicht nur in Wien. So findet sich in Leipzig, nicht in Wien, das am längsten durchgehend betriebene Kaffeehaus im deutschsprachigen Raum. Der Kaffee kam auch nicht ursprünglich aus der Türkei und war kein ,Mitbringselʻ der Türkenbelagerung vor Wien im Jahre 1683. Rote Bohnen des Arabica-Kaffeebaums sind seit etwa dem 9. Jahrhundert aus Süd-Äthiopien bekannt, zuerst im Raum Kaffa, wo auch heute noch Spitzenkaffee angebaut wird. Dabei hat der ähnlich klingende Ortsname Kaffa nicht einmal wirklich etwas mit dem Heißgetränk zu tun, das später über den Jemen mit den Nomaden der Wüste nach Arabien gelangte. Bald wurde dem Getränk der arabische Name „kahwa“ als Umschreibung für Wein verpasst, aus dem sich dann das deutsch-italienisch-französische „Kaffee“ herleiten lässt. Man hat in der muslimischen Gelehrtenwelt schließlich entschieden, dass das Getränk gottgefällig sei. So konnte man den Pilgern Kaffeeschenken schon im 15. Jahrhundert in Mekka und Medina anbieten, später auch in Kairo. Bevorzugtes Anbaugebiet der Kaffeepflanzen war über Jahrhunderte der Jemen, dann erst die gesamte arabische Halbinsel. Schließlich landete das Getränk spätestens im 16. Jahrhundert in Konstantinopel (Istanbul), wo seit 1554 Kaffeehäuser bekannt sind. Hieran konnte die europäische Kaffeetradition, zunächst nur vereinzelt, anknüpfen.
Die weitgereisten und weltoffenen Venezianer waren wohl die ersten im westlichen Europa, die im 17. Jahrhundert mit einer „Bottega del caffè“ begannen. Viele Häuser folgten. Das Café Florian des Floriano Francesconi hat seit Ende 1720 am Markusplatz geöffnet. Schon im 17. Jahrhundert hat es Kaffeehäuser verteilt über ganz Europa gegeben, 1652 in London, dann 1660 in Marseille, 1666 in Amsterdam, 1669 in Paris und 1677 in Hamburg. Erst seit 1685 kennt man in Wien ein Kaffeehaus, wie eine Studie zum Wiener Kaffeehaus von Sabrina Wolfschluckner nachweist. Die Lizenz zum Ausschank von Wiener Kaffee (und Tee) hatte der Armenier Johannes Diodato. Die meisten alten Kaffeehäuser gibt es nicht mehr, schon gar nicht in Wien. Durchgängig geführt wird das seit 1686 betriebene Café Prokop in Paris und weiters der Leipziger „Coffebaum“ oder „Zum Arabischen Coffebaum“, ein Kaffeehaus, das nachweislich seit 1711 auch noch im selben historischen Gebäude betrieben wird. Nach jahrelangen Baumaßnahmen ist es endlich Ende 2024 wiedereröffnet worden. Womit wir im Leipzig des Johann Sebastian Bach angekommen sind, das mit exquisiten Unterhaltungen aufwarten konnte. Leipzig pflegte im 18. Jahrhundert eine Kaffeehaustradition mit Musikdarbietungen, so wie das Wien der Ära Kaiser Franz Josephs für das Literatencafé bekannt ist.
Merken wir uns in Leipzig das „Zimmermann’sche Kaffeehaus“. Wenn zu Anfang der Kaffeekantate die Aufforderung zu hören ist: „Schweigt stille, plaudert nicht“, dann war damit das „Plappern“ und „Schnattern“, gemischt mit dem Scheppern der Kaffeeservices, der ,Köppchen‘ und Kaffeeschalen im Café Zimmermann an der Leipziger Katharinenstraße gemeint. Denn hier, am Leipziger Markt, wurde Bachs Kaffeekantate 1734 uraufgeführt. Das Besondere des im Zweiten Weltkrieg untergegangenen Hauses war die Möglichkeit, überaus gut vor Publikum konzertieren zu können. Der große Saal konnte mehr Gäste aufnehmen als unser Tanzmeistersaal in Salzburg. Hier leitete der Jurastudent Georg Philipp Telemann und später der „Director musices“ Johann Sebastian Bach ein Studenten-Ensemble, genannt „Collegium Musicum“.
Das launige Vokalstück Bachs handelt vom Kaffeekonsum junger Mädchen. Das bevorzugte Getränk der Damen war übrigens nicht unbedingt der Kaffee, sondern die „cioccolata calda“, der heiße Kakao, für den es ein eigenes Service gab, das vor Schokoflecken schützen sollte. „Ei! wie schmeckt der Coffee süße“, heißt es bei Bach über die Kaffeezubereitung. Auch die Schokolade wurde mit viel Zucker getrunken. Das Sortiment damaliger „Specereyen“ ist hier beisammen: Kakao- und Kaffeebohnen, dazu Rohrzucker mit Herkunft aus Arabien, Afrika, Zentralamerika und der Karibik – Kaffee und Kakao, das waren hochpreisige Genussmittel.
Die Kaffeekantate BWV 211 gehört zu Bachs von der Zahl her überschaubaren weltlichen Kantaten, die zumeist Huldigungsmusiken darstellen. Aber dieses Stück hat eine spezielle Form, ist eine Art Mini-Singspiel für drei Protagonisten, auch wenn es das streng genommen noch gar nicht gegeben hat. Bachs Vokalwerk hat eine gewisse Verwandtschaft zu Mozarts Bandel-Terzett (KV 441). Auch hier sind drei Personen in gleicher Stimmlage beteiligt. Weitere Gemeinsamkeiten sind eine kleine Besetzung, humoristischer Inhalt; es geht um Modeaccessoires, und das Stück hat eine Schlusspointe. Bach hat sein Werkchen „Drama per Musica: Schlendrian mit seiner Tochter Ließgen“ genannt. Den hochtrabenden Namen „Drama per Musica“ hat Bach sonst für Glückwunschkantaten verwendet. Ist der Begriff hier vielleicht ironisch zu verstehen? Geht es hier doch um nichts anderes als eine humorvolle Szene für eine Sängerin, zwei Sänger, dazu Soloflöte, Streicher und Basso continuo. Der Text stammt vom Librettisten Henrici, genannt Picander, der für Bach zahlreiche geistliche Kantaten und die Matthäus-Passion verfasst hat. Der Stoff wurde übrigens nicht nur von Bach vertont.
Der Vater namens Schlendrian und die Tochter Elisabeth, das „Liesgen“ (gesprochen „Lieschen“), sind die beiden Protagonisten; ein Erzähler als dritter Sänger wirkt zur Vervollständigung mit. Das Ganze ist im Prinzip ein neckender Dialog zwischen Vater und Tochter. Alltagssprache ist gefragt.
Der Vater macht immer mehr Druck; er verbietet seiner renitenten Tochter, die das Kaffeetrinken nicht lassen kann, einen Hochzeitsbesuch und auch die Teilhabe an der neuesten Mode. Wenn es heißt: „Ich will dir keinen Fischbeinrock / nach itzger Weite schaffen“, dann bedeutet das, dass es sich bei dem vorenthaltenen Geschenk um einen Reifrock handelt, der um 1730 nach Pariser Mode kuppelförmig ausgeweitet war. Und zum Schmuck der jungen Dame würde es keine Bänder geben, die man zur Zierde irgendwo anbringen konnte: „Du sollst auch nicht von meiner Hand / ein silbern oder goldnes Band / auf deine Haube kriegen!“ – Doch Liesgen bleibt stur, das macht ihr alles nichts aus. Dann aber kommt vom Vater ein Stichwort, das sie ,flasht‘: „Wohlan!“, spricht der Vater, „so musst du dich bequemen / auch niemals einen Mann zu nehmen.“ Sie lenkt sofort ein, schwenkt um. Lieber einen Mann als ewig alleine den Kaffee zu trinken. „Heute noch“, will sie „einen wackern Liebsten“ haben. Wir hören eine sehnsuchtsvolle Arie im Siciliano-Stil.
Die Pointe der Dichtung von Picander ist, dass der Vater seine Tochter überlistet, indem er sie vor die Alternative Kaffeegenuss oder Ehemann stellt. Mit dem geistesgegenwärtigen Schwenk der Tochter endet Picanders Dichtung von 1732. Bach aber setzt noch eins drauf. Er vertont in „seiner“ Kaffeekantate von 1734 noch die Zeilen für ein weiteres Rezitativ und für ein Vokalterzett als Finale: Das Rezitativ verrät nun, dass die Tochter ihre Zusage insgeheim abgewandelt hat, dass jeder Mann, der ihr ins Haus kommt, sie beim „Coffee kochen“, wann immer es ihr beliebt, nicht stört. Schließlich folgt ein herrliches Ensemble mit fugierten Einwürfen, das einen bekannten Sinnspruch von Äsop aufgreift: „Die Katze lässt das Mausen nicht“. Man kann also niemanden umkrempeln, der aufs Kaffeetrinken fixiert ist. Das ist der Sieg der Tochter! So endet das Stück mit einem Lob auf die Frauen, die den Kaffee zu genießen wissen. Bach setzt also nach Picanders Finale eine ganz andere Pointe hinzu. Denn nun hat die Tochter wiederum ihren Vater ausgetrickst, der einsehen muss, dass der Kaffee zum Alltag eines bürgerlichen Mädchens von 1734 dazugehört. Mit dem Verweis auf die Tradition wird auch die Begründung nachgeliefert. Sie lautet, dass die „Coffeeschwestern“, also die Damenkränzchen in der Stadt, das Kaffeetrinken pflegen und schon die „Großmama“ Kaffee geschätzt habe. Kaffeetrinken, so die Botschaft, habe doch in der Damenwelt eine unverrückbare Tradition – für 1734 durchaus fortschrittlich, wenn man bedenkt, dass es bis ins 19. Jahrhundert Warnungen gab, Frauen sollten doch aufs Kaffeetrinken verzichten. Die Begründung: Die Kaffeehäuser seien doch allzusehr verr(a)ucht …
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 70-75
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe