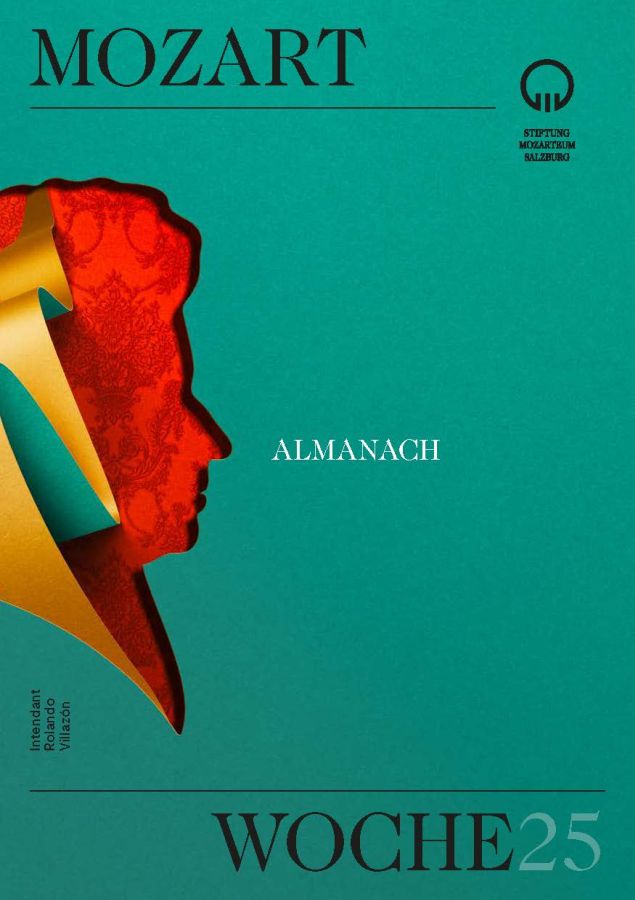- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 105-111
Briefe und Musik
Text: Ulrich Leisinger
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 105-111 [Programmheft]
Mozarts Briefe versetzen uns immer wieder auf kurzweilige Art in die Gedankenwelt des Genies. Sein Schreibstil ist pointiert und witzig. Mozart beschrieb sich selbst als gutmütig, aber dies galt nur, solange er und seine Kunst ernst genommen wurden. Er reagierte schroff und geradezu unhöflich, wenn er sich beleidigt fühlte oder wenn jemand abfällig über Komponisten sprach, die er selbst schätzte. Seine Reaktion auf Georg Joseph Vogler, sicherlich eine der schillerndsten Persönlichkeiten, denen er je begegnet ist, ist in dieser Hinsicht bezeichnend. Während seines Aufenthalts in Mannheim 1777 erfuhr Mozart, dass Johann Christian Bach, einst einer seiner Gönner in London während der großen Westeuropareise, Lucio Silla für den Hof des Kurfürsten von der Pfalz vertont hatte. Er war neugierig zu sehen, wie Bach mit dem Text, den er selbst ein paar Jahre zuvor für sein letztes Auftragswerk für Mailand verwendet hatte, umgegangen war. Vogler, damals stellvertretender Kapellmeister am Mannheimer Hof, übergab ihm die Partitur mit den Worten, dass er nicht erwarten solle, darin irgendetwas von Belang zu finden. Als Mozart ihm einige Tage später sagte, dass ihm eine der Arien sehr zusagte, zog Vogler über Pupille amate her und bezeichnete die Arie als eine „Sauerey“, die Bach im Punschrausch geschrieben haben müsse. Vogler konnte nicht ahnen, dass der Text gerade dieser Arie zu den Favoritstücken in der Mozart-Familie gehörte. Mozart ärgerte sich, schwieg – diesmal –; aber so diplomatisch war er freilich nicht immer …
Mozart sparte in seinen Briefen nicht mit Kritik; dasselbe gilt für die Antworten seines Vaters. Mozart ist kein nüchterner Chronist, sondern immer mit Herz und Seele dabei. Er analysiert scharf und offenherzig die Stärken und Schwächen seiner musikalischen Zeitgenossen. Seine wenigen Elogen dürfen durchaus wörtlich genommen werden.
Mozart lobte in seinen Briefen immer wieder angesehene Musiker seiner Zeit wie etwa den Geiger Ignaz Fränzl. Nachdem er ihn in Mannheim spielen gehört hatte, schrieb er dem Vater, dass ihm Fränzls Spiel sehr gefalle, weil dieser schwere Stücke so vortrug, dass sie einfach klängen, und lobte den schönen, runden Ton. Über die noch bedeutenderen Violinvirtuosen, die er einige Monate später in Paris gehört haben muss – Giovanni Battista Viotti und Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges –, verlor er hingegen kein einziges Wort. Darüber, weshalb er nach seinem Aufenthalt in Paris aufgehört hat, öffentlich Geige zu spielen, lässt sich daher nur spekulieren!
Letztlich sind es genau zwei Musiker, die Mozart besonders wertschätzte. Über sein Verhältnis zu Joseph Haydn, der fast eine Generation älter als er war, ist schon viel geschrieben worden. Hier soll nur daran erinnert werden, dass Sympathie und Respekt auf Gegenseitigkeit beruhten: Mozart widmete dem ,Erfinderʻ dieser Kammermusikgattung seine Streichquartette op. 10, während Haydn nach Proben der Quartette während Leopold Mozarts Besuch in Wien im Frühjahr 1785 bekannte, dass Wolfgang der größte Komponist sei, den er kenne.
Nicht weniger herzlich war Mozarts Beziehung zu Johann Christian Bach seit dem Aufenthalt von 1764/65 in London. Abgesehen von einer charmanten Anekdote ist allerdings wenig über ihre Begegnungen während dieser Zeit bekannt. 1766 gab Melchior Grimm, der Wohltäter der Mozarts in Paris, eine kurze Beschreibung der Grand Tour und berichtet, dass Bach den jungen Mozart zwischen die Knie nahm und sie so gemeinsam stundenlang für den König und die Königin auf einem Klavier spielten.
Die Geschichte zeigt, dass es Johann Christian Bach, Musiklehrer von Königin Charlotte, war, der die Pforten zum königlichen Palast öffnete. Die Audienzen bei der königlichen Familie führten schließlich zu dem Auftrag, sechs Trios (KV 10–15) mit obligatem Klavier für die Königin zu schreiben, die als Mozarts Opus 3 veröffentlicht wurden. In Salzburg ist das Manuskript einer Bach-Sonate erhalten, bei der ein Satz von der Hand des Komponisten selbst stammt; gewiss handelt es sich hierbei um ein persönliches Souvenir Bachs für die Mozart-Familie.
Die Darstellung in Charles Burneys General History of Music, from the Earliest Ages to the Present Period, die zwischen 1776 und 1789 in vier umfangreichen Bänden veröffentlicht wurde, kann die Lücke, die die Mozart-Briefe hinterlassen, ein Stück weit füllen. Burneys Bericht liefert eine lebendige Darstellung von Bachs frühen Londoner Jahren und damit auch einen besseren Einblick in Mozarts dortigen Aufenthalt.
1778 trafen sich Bach und Mozart noch einmal in Paris, wohin Bach aus London gereist war, um Absprachen für seine neue Auftragsoper Amadis de Gaules zu treffen, die dort am 14. Dezember 1779 uraufgeführt werden sollte. Die beiden Meister knüpften nahtlos an die Erinnerungen an die Vergangenheit an. Am 10. April 1782, wenige Monate nach Bachs Tod im Alter von 46 Jahren, schrieb Wolfgang schließlich seinem Vater Leopold: „Sie werden wohl schon wissen daß der Engländer Bach gestorben ist? – schade für die Musikalische Welt!“
Bachs Bedeutung als Komponist und Vorbild kann kaum überschätzt werden. Mozart ließ sich von dessen Werken inspirieren: Wissenschaftler haben eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Mozarts und Bachs Kompositionen erkannt, die als Reverenzen gegenüber dem väterlichen Freund gewertet werden können. Dazu gehören zum Beispiel der langsame Satz des Konzerts A-Dur für Klavier KV 414 (nach Bachs Ouvertüre zu La calamita de’ cuori) sowie das Hauptthema des Rondos D-Dur KV 485 (aus dem Klavierquintett op. 11, Nr. 6, stammend), ein Thema, das Mozart bereits en passant im Schlusssatz des Klavierquartetts g-Moll KV 478 zitiert hatte. Ähnliche Anspielungen finden sich übrigens in Bachs eigenen Werken, der zum Beispiel seinem Vater Johann Sebastian Tribut zollte, indem er den Beginn der Partita B-Dur BWV 825 in seiner Violinsonate in derselben Tonart, mit der er sein op. 10 eröffnete, aufnahm.
Mozart urteilte schnell, und nicht alle seine Urteile waren fair. Mehr als einmal musste er seine eigene Meinung rasch wieder revidieren. So widerrief er seine abschätzigen Bemerkungen über den Tenor Anton Raaff, als er ihn ein weiteres Mal singen gehört hatte, und bezeichnete ihn später sogar als seinen Freund. Umgekehrt ist es durchaus amüsant zu lesen, wie sich seine anfängliche Begeisterung über die kompositorische Begabung von Marie-Louise-Philippine Bonnières de Souastre, die Tochter des Duc de Guines, abkühlte.
Bei spöttischen und geringschätzigen Formulierungen über andere sollte man jedoch stets bedenken, dass die Mozarts keine gerichtlich verwertbaren Zeugenaussagen ablegten, sondern sich gegenseitig Geschichten auftischten, die sowohl informativ als auch unterhaltsam sein sollten, aber als private Mitteilungen gar nicht für fremde Augen und Ohren bestimmt waren.
In vielen Fällen haben wir keine unabhängigen Informationsquellen, um zu verifizieren oder falsifizieren, was sich die Mozarts so erzählten. Anders ist dies bei der Bewertung des musikalischen Wettstreits mit Muzio Clementi, der am 24. Dezember 1782 auf Initiative Josephs II. stattfand; auch der jüngere Bruder des Kaisers, Leopold Großherzog von Toskana, und seine Frau Maria Luisa waren damals anwesend. Eine Anekdote über diese Begegnung wurde bereits 1805 veröffentlicht. Es wird dort berichtet, dass die beiden Musiker bei Hof einbestellt wurden. Der Kaiser ließ auf sich warten, worauf sie jeder an einem Instrument vor sich hin spielten, bis dem Fremdling bei „einer vorzüglich schönen Stelle“ entfuhr „‚Sie sind Mozart!‘ – ‚Sie sind Clementi!‘, antwortete der andere, und sie fielen sich in die Arme.“
Am 16. Jänner 1782 hatte Mozart seinem Vater den Ablauf des musikalischen Wettstreits geschildert, den spätere Autoren dramatisch zum Kampf, wenn nicht gar Duell stilisiert haben: „Nun vom Clementi. – dieser ist ein braver Cembalist. – dann ist auch alles gesagt. – er hat sehr viele fertigkeit in der rechten hand. – seine hauptPasagen sind die Terzen. – übrigens hat er um keinen kreutzer geschmack noch empfindung. – ein blosser Mechanicus.“
Wie Mozart war auch der 1752 geborene Clementi ein Wunderkind. Er erhielt schon mit sechs Jahren Klavierunterricht und wurde auch in Komposition und Gesang ausgebildet. Zu seinen frühesten Kompositionen – heute verloren – gehören eine Vertonung des Messordinariums und ein Oratorium, die öffentlich aufgeführt wurden, als er zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Es ist zwar eine fromme Legende, dass er seine erste Stelle als Organist bereits im Alter von neun Jahren erhalten habe, aber mit vierzehn Jahren wurde er tatsächlich in dieser Eigenschaft an San Lorenzo in Damaso in seiner Heimatstadt Rom angestellt.
Ein reisender Engländer, Sir Peter Beckford, überzeugte die Familie, den Jungen zur weiteren Ausbildung nach England zu senden. Auf dem Landsitz Beckfords in Dorset verbrachte er Tag und Nacht damit, die Werke von Bach und seinen Söhnen, von Händel und Domenico Scarlatti am Cembalo zu üben. Eine späte Hommage an diese Zeit, da Musik sowohl Studium wie Zeitvertreib war, sind vier Bände mit Musik für Tasteninstrumente, die in seinem eigenen Verlag unter dem Titel Clementi’s Selection of Practical Harmony, for the Organ or Piano Forte; Containing Voluntaries, Fugues, Canons, & Other Ingenious Pieces by the Most Eminent Composers erschienen sind. Sie enthalten eine große Auswahl an Werken vom 17. bis zum späten 18. Jahrhundert. Mozart war im Übrigen mit Abstand der jüngste Komponist, der in dieser historischen Übersicht vertreten ist. Clementi fertigte Klavierauszüge der Kyrie-Fuge aus Mozarts Requiem KV 626 und des Allegro und Andante f-Moll für eine Orgelwalze KV 608 an, während das Repertoire sonst fast ausnahmslos aus Originalkompositionen im „alten Stil“ bestand.
Die Werke von Domenico Scarlatti spielten in Clementis Werdegang eine durchaus entscheidende Rolle. Scarlattis Kompositionen verlangen nicht nur gerade die technischen Fertigkeiten, die Mozart im Brief an den Vater hervorhob, sondern dienten Clementi auch als kompositorische Vorbilder, wie man beispielsweise am halsbrecherischen Presto aus dessen Sonate fis-Moll op. 25, Nr. 5, sehen kann, die 1790 im Druck erschienen ist. (Eine Scarlatti-Reminiszenz findet sich mindestens einmal auch bei Mozart: im langsamen Satz der frühen Violinsonate KV 30, bei der sich rechte und linke Hand des Klaviers immer wieder kreuzen.)
Mozart berichtete schließlich weiter, dass der Kaiser sie abwechselnd vorspielen ließ, wobei er ein Präludium improvisierte und Variationen vortrug. Danach mussten sie, Satz für Satz abwechselnd, Sonaten von Giovanni Paisiello aus dessen schwer lesbarer Originalhandschrift vom Blatt spielen. „Dann nammen wir ein thema daraus, und führten es auf 2 Piano forte aus.“
Die Nachwelt hat schnell den Mythos konstruiert, Mozart habe Clementi in Grund und Boden gespielt. Andernorts wird jedoch behauptet, dass Joseph II. den Wettstreit für unentschieden erklärt habe. Dies war vielleicht nicht nur eine gerechte, sondern auch eine weise Entscheidung, schon allein um Zwist mit seiner Schwägerin zu vermeiden. Diese war angeblich bereit, Clementi die stolze Summe von 50 Dukaten zu zahlen, während der Kaiser Mozart den gleichen Betrag ausgehändigt haben soll.
Und wie steht es um Clementis Sicht auf diese Begebenheit? Viel spricht dafür, dass die Anekdote von 1805 unmittelbar auf ihn zurückgeht, denn er hielt sich nachweislich gerade um diese Zeit in Berlin auf. In einem Neudruck seiner Sonate B-Dur op. 24, Nr. 2, die etwa zur selben Zeit erschien, fügte er die Anmerkung hinzu, dass er dieses Werk dem Kaiser in Mozarts Anwesenheit vorgespielt habe. Die Sonate ist, wie jeder gerne zugestehen wird, die Keimzelle für die Ouvertüre zur Zauberflöte!
Mozart traf rasch und mit spitzer Zunge und Feder Urteile wie „Mr. Bach von London [ist] ein Ehrenmann“ und „Clementi ist ein Ciarlatano“. Aus seiner Sicht und mit Blick auf die Personen, an die er sich mit diesen Äußerungen wandte, mag er sich im Recht gesehen haben. Aber schon Leopold wusste, dass nicht jedes Wort seines Sohnes für bare Münze genommen werden durfte. Und deshalb soll im heutigen Programm auch ausnahmsweise Clementi und nicht Mozart das letzte Wort haben.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 105-111
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe