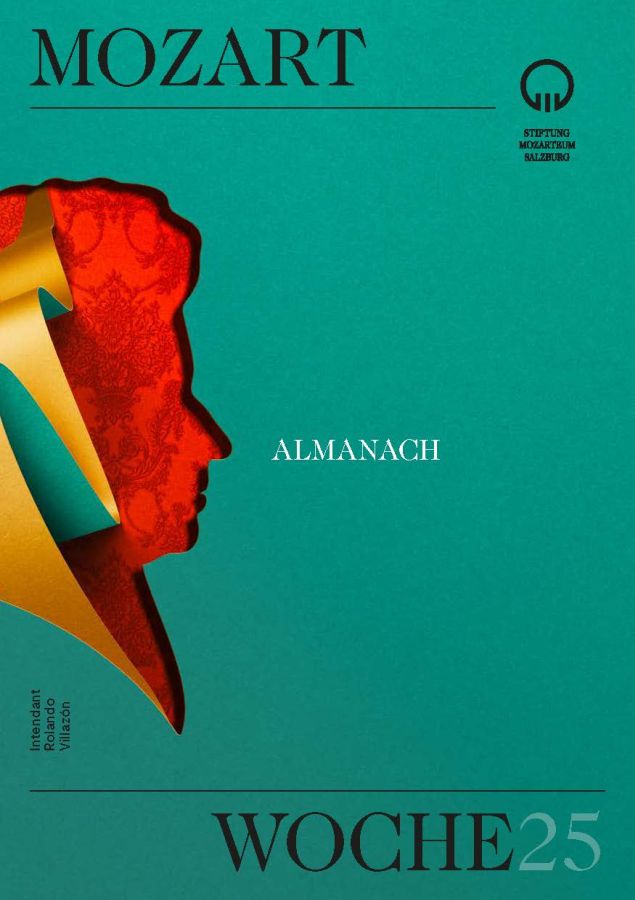- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 135-142
Die Oper
Text: Peter Wollny
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 135-142 [Programmheft]
CLAUDIO MONTEVERDI
L’Orfeo
Der Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert gilt als eine der großen Zäsuren in der Musikgeschichte, und speziell das Jahr 1600 wird häufig plakativ mit dem Epochenwechsel von der Renaissance zum Barock gleichgesetzt. Sucht man nach spezifischen Argumenten für diese Gliederung, so tritt zum einen die zu dieser Zeit aufkommende Gattung der Oper ins Blickfeld, zum anderen deren erster bedeutender Komponist: Claudio Monteverdi. Doch Neuerungen entstehen nicht voraussetzungslos, und lange etablierte Traditionen verschwinden nicht über Nacht. Die detaillierte Erforschung der komplexen Vorgeschichte der ersten musikalischen Bühnenwerke reicht weit ins 16. Jahrhundert zurück und deckt die gemeinschaftlichen, doch zugleich einander häufig widersprechenden Bemühungen einer Gruppe von humanistischen Gelehrten auf, denen es um die künstlerische Weiterentwicklung und stilgerechte Darbietung der klassischen antiken Dramen ging. Nach gründlichem Studium der historischen Quellen glaubten die in der sogenannten Florentiner Camerata vereinten Musiker, Dichter und Philologen diesen entnehmen zu dürfen, dass die griechischen Schauspieler ihre Texte in einer Art Sprechgesang darstellten. Allerdings gab es für diese Musik keine konkreten Zeugnisse, daher sahen sich die Komponisten der Camerata aufgefordert, den dramatischen Sologesang der Antike mit den musikalischen Mitteln ihrer Zeit neu zu erschaffen. Die Ergebnisse dieser frühen Bemühungen sind zum Teil erhalten: 1598 schufen Jacopo Corsi und Jacopo Peri eine Dafne, 1600 komponierten Peri und Giulio Caccini ihre eigenen Realisierungen der Euridice, und Emilio de’ Cavalieri versuchte sich im selben Jahr mit seiner Rappresentatione di Anima, et di Corpo an einem geistlichen Sujet. Der eigentliche Durchbruch gelang aber erst einige Jahre später, als Claudio Monteverdi in seiner Funktion als Kapellmeister des Herzogs Vincenzo Gonzaga in Mantua seinen Orfeo präsentierte. Es entbehrt nicht der Ironie, dass die Lösung des Problems einer effektvollen Verbindung von Musik und Drama im Sinne der damaligen Antikenrezeption ausgerechnet einem Komponisten gelang, der sich – soweit wir wissen – eigentlich gar nicht so recht für die Vergangenheit und historische Fragestellungen interessierte, sondern grundsätzlich eher von kühnen Experimenten fasziniert war.
Claudio Monteverdi wurde 1567 in Cremona als ältester Sohn eines Wundarztes geboren. Obwohl die Familie in beengten Verhältnissen lebte, sorgte der Vater dafür, dass sein Erstgeborener bei dem Kapellmeister des Cremoneser Doms, Marc’Antonio Ingegneri, eine gründliche musikalische Ausbildung erhielt. Früchte des Unterrichts bei diesem der Schule des strengen kontrapunktischen Stils verpflichteten Komponisten sind Monteverdis erste Veröffentlichungen, die er im Alter von 15 und 16 Jahren vorlegte: die Motetten-Sammlung Sacræ cantiunculæ und ein Buch mit Madrigali spirituali. 1587 schloss er seine Lehrzeit mit der Drucklegung seines ersten Madrigalbuchs ab, und 1590, im Alter von 23 Jahren, wurde er an den Hof des Herzogs Vincenzo Gonzaga nach Mantua berufen. In der mit exquisiten Musikern besetzten herzoglichen Kapelle wirkte er als Sänger und Violaspieler. In dieser Funktion dürfte der junge Musiker mit den Experimenten der Florentiner Camerata und speziell der dort betriebenen Suche nach neuen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten in Verbindung gekommen sein. Jedenfalls war ihm der strenge Stil seines Lehrmeisters anscheinend zunehmend suspekt; in seinen neuen Kompositionen bemühte er sich um eine expressiv gesteigerte Umsetzung des Texts, die ihn auch vor bewussten Verstößen gegen die traditionelle Satzlehre nicht zurückschrecken ließ. Seine kühnen Experimente fanden ein ungewöhnlich großes Echo dank einer vernichtenden Kritik, die der eminente Musiktheoretiker Giovanni Maria Artusi in den Jahren 1600 und 1603 veröffentlichte. Auch wenn Monteverdi sich zunächst nicht verteidigte, scheint ihm der Angriff nicht geschadet zu haben, denn der Herzog ernannte ihn 1601 zum Kapellmeister. Erst 1605, im Vorwort seines fünften Madrigalbuchs, ging Monteverdi auf Artusis Kritik ein und tat sie als gegenstandslos ab, da er in seinen Werken einen neuartigen, von ihm als „seconda prattica“ bezeichneten Kompositionsstil pflege, in dem die beanstandeten Passagen nicht als Fehler, sondern als bewusst eingesetzte Freiheiten zu interpretieren seien, mit denen die Aussage des Texts sinnfällig gemacht werde.
Das Konzept der „seconda prattica“ – das Außerkraftsetzen der Kontrapunktregeln im polyphonen Satz – wurde schon bald durch das Aufkommen weiterer revolutionärer Neuerungen relativiert. Überhaupt scheinen die italienischen Musikerkollegen aus Monteverdis Generation sich im Erfinden neuer Stile und Kompositionstechniken einen wahren Wettstreit geliefert zu haben. Eine von seinem Zeitgenossen Giulio Caccini veröffentlichte Sammlung von lediglich von einem Generalbassinstrument begleiteten Sologesängen trug den Titel Le nuove musiche. Ein anderer – Emilio de’ Cavalieri – experimentierte mit Mikrointervallen, die kleiner als ein Halbtonschritt waren. Und Monteverdi selbst erfand mit seinem „stile concitato“ die Möglichkeit, den Affektzustand äußerster Erregung darzustellen. Mit diesem Zuwachs an kompositorischen Darstellungsmöglichkeiten war das Feld bereitet für das auf der Bühne gesungene und gespielte musikalische Drama – die Oper war geboren, und es war vor allem Monteverdi, der erkannt hatte, dass die neue Gattung nicht mittels einer umsichtig tastenden Suche nach den verschollenen Gesangs- und Schauspielkünsten der Antike künstlerisch zu meistern war, sondern in der radikalen Verknüpfung der jüngsten Stilexperimente.
Am Hof zu Mantua waren die Bedingungen hierfür günstig. Herzog Vincenzo Gonzaga (1562–1612) entwickelte Mantua in seiner Regierungszeit zu einem Zentrum der Künste. Bei der ersten großen Opernproduktion scheint sein Sohn Francesco (1586–1612) die treibende Kraft gewesen zu sein. Francesco beauftragte (vermutlich in der zweiten Hälfte des Jahres 1606) den Juristen Alessandro Striggio mit der Ausarbeitung eines Librettos über die Orpheus-Sage wie sie im zehnten und elften Buch von Ovids Metamorphosen überliefert ist. Anfang Jänner 1607 dann bat Francesco seinen jüngeren Bruder Ferdinando (1587–1626), in Florenz einen für Musikdarbietungen während der Karnevalssaison bekannten Kastraten namens Giovanni Gualberto Magli zu engagieren. Auf ähnlichem Weg wurden anscheinend weitere auswärtige Sänger und Instrumentalisten nach Mantua verpflichtet.
Es steht zu vermuten, dass Monteverdi seine musikalischen und dramatischen Vorstellungen mit dem Librettisten abstimmte. Anhand zahlreicher Ähnlichkeiten ist zu erkennen, dass der Mantuaner Orfeo als Reaktion auf die wenige Jahre zuvor in Florenz aufgeführte Euridice gedacht war, die er künstlerisch, musikalisch, sprachlich und dramaturgisch in den Schatten zu stellen suchte. Monteverdi hatte die Erstaufführung der Florentiner Euridice erlebt und 1605 in Mantua bereits eine Ballettmusik mit dem Titel Gli amori di Diana ed Endimone aufgeführt. Seine Umsetzung von Striggios Libretto zeichnete sich durch die geniale Vermischung unterschiedlichster neuerer wie auch älterer Formen und Techniken aus, darunter die strophische Aria, das dramatische Rezitativ und die große monodische Szene. Seine Erfahrungen als Madrigalkomponist kamen dem Werk mit seinen zahlreichen Chören ebenso zugute wie seine Vertrautheit mit dem Ballett die Tanzszenen und instrumentalen Ritornelle inspirierte.
Die Premiere von L’Orfeo fand am 24. Februar 1607 im Palazzo Ducale von Mantua statt. Zeitgenössischen Dokumenten ist zu entnehmen, dass die Aufführung ein überragender Erfolg war; besonders Herzog Vincenzo soll tief beeindruckt gewesen sein. Dass die Darbietung eine solche Wirkung entfalten konnte, war nicht zuletzt auch den Musikern zu verdanken. Die Titelrolle übernahm der berühmte Tenor Francesco Rasi, den Herzog Vincenzo bereits 1598 an seinen Hof gerufen hatte. Aus Florenz wurden offenbar nicht weniger als vier versierte Sänger verpflichtet, darunter auch der seinerzeit frenetisch gefeierte Kastrat Giovanni Gualberto Magli.
Eine große Besonderheit von Monteverdis Orfeo ist die mit üppigen Klangfarben brillierende Besetzung des Orchesters. Der 1609 erschienene Erstdruck der vollständigen Partitur nennt zu Beginn neben den Gesangsrollen die in der Erstaufführung eingesetzten Instrumente: „2 Gravicembani, 2 Contrabassi de Viola, 10 Viole da brazzo, 1 Arpa doppia, 2 Violini piccoli alla Francese, 2 Chitaroni, 2 Organi di legno, 3 Bassi da gamba, 4 Tromboni, 1 Regale, 2 Cornetti, 1 Flautino alla Vigesima seconda, 1 Clarino con 3 Trombe sordine“. In der Partitur selbst finden sich zusätzliche Angaben: „2 Violini ordinarii“, eine weitere Harfe, offenbar ein weiteres Regal sowie fünf (statt drei) „Trombe“. Doch nicht nur die außergewöhnlich opulente Besetzung ist bemerkenswert, sondern auch die Art, wie die einzelnen Instrumente zur Charakterisierung der jeweiligen Szene eingesetzt werden. In den ersten beiden Akten, die eine heiter-bukolische Stimmung im Reich der Nymphen und Schäfer schildern, kommen neben den besaiteten Continuo-Instrumenten die Streicher und Flöten zum Einsatz. Der abrupte Wechsel in die Unterwelt in Akt III wird durch den Einsatz der von den Orgeln begleiteten Zinken und Posaunen illustriert. Der die Götter des Hades bezwingende liebliche Gesang des Orpheus (in der Monodie „Possente spirto“) er hält seine unverwechselbare Farbe dank Doppelharfe und zwei Soloviolinen.
Mit seinem Orfeo – der Fabel von der Macht der Musik – ist Monteverdi ein Meisterwerk gelungen, das seine Hörer auch mehr als vierhundert Jahre nach seiner Entstehung verblüfft und fasziniert. Es wird sich kaum eine zweite Oper aus dem 17. Jahrhundert finden lassen, die auf solch vollkommene Weise kühnes Experiment mit solidem Handwerk und musikalischen Reichtum mit konzeptioneller Geschlossenheit zu verbinden wusste.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 135-142
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe