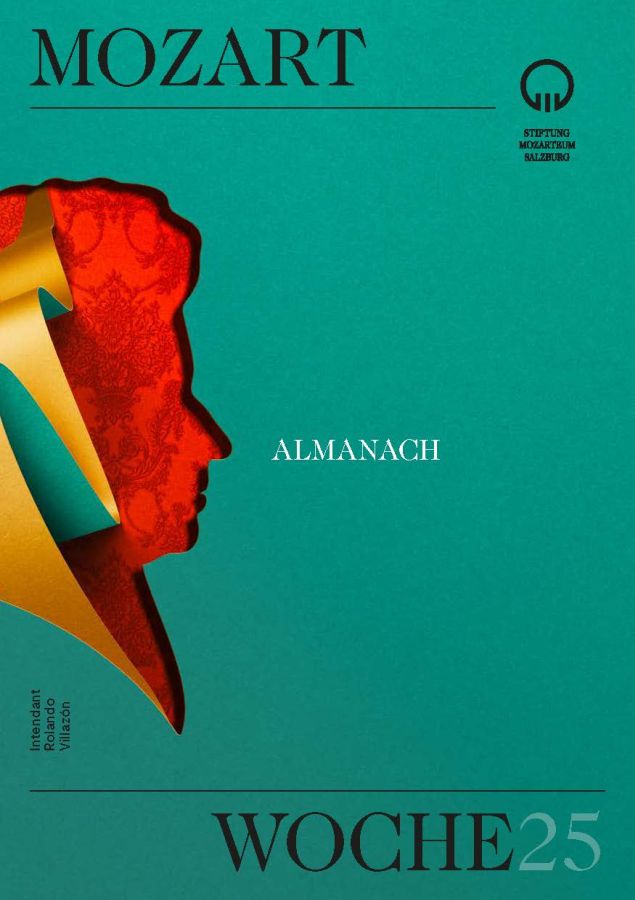- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 219-224
Das Werk
Text: Daniel Floyd
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 219-224 [Programmheft]
G. F. HÄNDEL / MOZART
Das Alexander-Fest oder die Gewalt der Musik
Gottfried Freiherr (Baron) van Swieten war Diplomat im Dienste der Habsburgermonarchie, bevor er 1777 zum Präfekten der Kaiserlichen Hofbibliothek in Wien ernannt wurde. Van Swieten sammelte Manuskripte von Werken Georg Friedrich Händels, Johann Sebastian Bachs und anderer Barockkomponisten und veranstaltete in seiner Wohnung Konzerte für Musikkenner. Unter den anwesenden Komponisten war auch Wolfgang Amadé Mozart, der am 10. April 1782 an seinen Vater schrieb, „ich gehe alle Sonntage um 12 uhr zum Baron van Suiten – und da wird nichts gespiellt als Händl und Bach“. Neben den Konzerten in van Swietens Wohnung, auf die sich Mozart in seinem Zitat bezieht, organisierte der Baron Aufführungen von Händels Oratorien, allerdings in deutscher Übersetzung und in neuer Orchestrierung. Daher beauftragte van Swieten Mozart zwischen 1788 und 1790, vier Oratorien von Händel zu bearbeiten: Acis und Galatea, Der Messias, Das Alexander-Fest und die Cäcilien Ode. Beginnend mit Judas Makkabäus (HWV 63) im März 1778, initiierte der Baron eine Reihe von Händel-Oratorienaufführungen in Wien. Er konnte private Mäzene gewinnen („Gesellschaft der Associierten Cavaliere“), die in den 1780er- und 1790er-Jahren weitere Vorstellungen von Händel-Oratorien in Adelshäusern, unter anderem bei Graf Johann Esterházy und Fürst Karl Lichnowsky, finanzierten.
Händels Vertonung von Drydens Gedicht
John Drydens Alexander’s Feast; or The Power of Musique. An Ode, in Honour of St. Cecilia’s Day [Das Alexander-Fest; oder die Gewalt der Musik. Eine Ode zu Ehren des Tages der heiligen Cäcilia] (1697), die auf einem historischen Bericht von Plutarch beruht, beschreibt, wie der Musiker Timotheus mit Gesang und Spiel auf der Lyra die Empfindungen und das Verhalten Alexanders des Großen und seiner Gäste bestimmte, während sie ihren Sieg über die Perser in Persepolis (331 v. Chr.) feierten. Dryden veranschaulichte einen Sänger, der den mächtigsten Krieger der Antike in seinen Bann zieht, um den jährlichen Festtag der Heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Musik, am 22. November zu ehren.
Newburgh Hamiltons Libretto für Alexander’s Feast or The Power of Musick [Das Alexander-Fest oder die Gewalt der Musik] (HWV 75), das Drydens Ode in Rezitative, Arien und Chöre unterteilt, bot Händel die Möglichkeit, die Emotionen seines Publikums mit seinen musikalischen Schilderungen der Ereignisse bei dem antiken Bankett zu steuern. Händel vollendete die zweiteilige Kantate im Jänner 1736 und leitete die Uraufführung am 19. Februar 1736 im Covent Garden Theatre vor mehr als 1.300 Zuhörern. Die erfolgreiche Aufnahme veranlasste Händel zu 25 Aufführungen der Komposition in London zwischen 1736 und 1755. Händel vertonte daraufhin im Jahr 1739 Drydens A Song for Saint Cecilia’s Day (1687) als Ode for St. Cecilia’s Day [Cäcilien-Ode] (HWV 76).
Die Handlung
Der Tenor berichtet, dass „Philipps tapfern Sohn“ ein Fest zum Anlass des Triumphs seiner Armee über Persien angeordnet hat. Alexander der Große sitzt auf dem persischen Thron, gekrönt mit Rosen und Myrten, umgeben von seinen Soldaten und neben der holden Athenerin Thais. Die Hymne des Tenors wird anschließend von Sopran und Chor angestimmt: „Selig, selig, selig Paar!“. Der Sänger Timotheus, der es versteht, die Herzen der Menschen zu berühren, tritt ein und singt: Alexanders Vater ist nicht Philipp von Makedonien, sondern Zeus, der den Sitz der Götter verließ, weil ihn die Begierde nach Olympia lockte und er mit ihr ein „Bildnis von sich selbst, / Den zweiten Herrn der Welt“ zeugte. Die Anwesenden bejubeln Alexander als „unsre Gottheit hier“, und das Lied treibt ihn in einen Rausch, in dem er sich als Gott sieht: Er „Bewegt sein Haupt, / Und wähnt, es bebt die Welt“. Schon das erste Lied von Timotheus hat Alexander in einen Wahnzustand versetzt, in dem er sich, unterstützt von den Äußerungen seiner Gäste, für einen Gott hält.
Verstärkt durch den Chor intoniert der Bass Timotheus’ Lobgesang auf „Bacchus, ewig schön und ewig jung“ und das anschließende Schwelgen. Alexander, die Augen leuchtend, die Wangen gerötet, schwärmt von seinen Taten: Er „ficht alle seine Schlachten durch, / Besieget dreimal seinen Feind“. Timotheus ändert die Stimmung schlagartig, indem er ein Trauerlied zu Ehren des gefallenen persischen Königs Darius singt. Wie der Chor bestätigt, wurde er von der Macht des Schicksals in den Tod gestürzt und auf dem Schlachtfeld allein gelassen. Alexander denkt über „den Wechsellauf des schnellen Glücks“ nach und beweint seinen verstorbenen Feind. Timotheus, der sieht, dass sein Lied Alexander zum Mitleid bewegt, weckt in ihm die Liebe zu Thais: „Krieg, o Held, ist Sorg’ und Arbeit“, singt der Tenor. Der Schlusschor des ersten Teils, der von einer Sopranarie unterbrochen wird, in der Alexander nach der schönen Thais schmachtet, preist die Liebe und die Wirkung der Musik.
Zu Beginn des zweiten Teils, der der sechsten Strophe in Drydens Gedicht entspricht, befinden sich alle Beteiligten in einem Stumpfsinn, und der Tenor fordert im Rezitativ Timotheus auf: „Brich die Bande seines [Alexanders] Schlummers“. Alexander „erwacht, als vom Grab“ und schaut sich verwirrt um. Timotheus, so kündigt der Bass an, provoziert Zorn und Rache: „Gib Rach’, gib Rach’, gib Rach’! heult alles laut“. Die gespenstische Prozession der erschlagenen griechischen Helden animiert den angeheiterten Alexander dazu, eine Fackel unter großem Beifall seines Heeres auf die feindliche Stadt Persepolis zu werfen. Seine Geliebte ergreift die Initiative zur Zerstörung des persischen Palastes: „Thais führt ihn an, / und leuchtet zum Verderb“. Alle gehorchen Timotheus’ Ruf nach Vergeltung und brennen die Stadt in einem Wutanfall nieder, ein letzter Beweis in dieser Geschichte, wie viel Macht der Musiker über den König und seine Untertanen hat.
Ein Tenor-Accompagnato mit anschließendem Choreinsatz signalisiert einen plötzlichen zeitlichen Fortschritt, um die heilige Cäcilia zu rühmen. Obwohl Timotheus eine beeindruckende Fähigkeit bewiesen hat, mit seinen begrenzten Mitteln die Stimmung seines Publikums zu lenken, stellt ihn die Heilige Cäcilia in den Schatten, indem sie die Grenzen der Musik auslotet. Cäcilia, der die Erfindung der Orgel zugeschrieben wird, hat den „Raum der eingeschränkten Kunst“ erweitert und Möglichkeiten geschaffen, die „zauberhafte, reich an Phantasie“ sind. Der Tenor bittet Timotheus, seinen Lorbeerkranz für Cäcilia abzugeben, doch der Bass schlägt vor, den Preis beiden zu verleihen: „Er hob den Menschen himmelan, / Sie zog den Gott herab“. Dieser zunächst schlichte und deklamatorische Chorsatz wächst zu einer Quadrupelfuge an, deren Themen einzeln vorgestellt und zu einem massiven Chor vereint werden, in dem rasche Achtelnoten Timotheus repräsentieren, während er den mazedonischen König in den Himmel hebt, und feierliche Viertelnoten die heilige Cäcilia schildern, wie sie einen Engel auf die Erde herabzieht.
Mozarts Bearbeitung
Van Swieten beauftragte Mozart 1790 mit der Bearbeitung von Das Alexander-Fest (KV Anh. A 58 – bislang KV 591) nach der deutschen Übersetzung von Karl Wilhelm Ramler, Alexanders Fest, oder die Gewalt der Musick, eine Kantate (1766, revidiert 1770). Ramler passte seine Übertragung an Händels Musik an, ohne den allgemeinen Sinn von Drydens Gedicht zu verändern, so dass deutsche Worte auf eine in englischer Sprache konzipierte Komposition aufgepfropft werden konnten. Dabei mussten einige von Drydens besten Versen geopfert werden, um das Libretto für diese Partitur zu übersetzen. So verwandelte Ramler zum Beispiel „The Many rend the Skies, with loud Applause; / So Love was Crown’d, but Musique won the Cause“ in „Die ganze Schar erhebt ein Lobgeschrei: / Heil, Liebe, dir, Tonkunst, Ehr’ und Dank!“. Solche Schönheitsfehler sollten nicht von Ramlers unschätzbarem Werk ablenken, das den Wortrhythmus mit der Originalmusik akribisch verbindet.
Mozart veränderte den Klangcharakter, indem er Stimmen für Holzbläser und Ausschmückungen hinzufügte, um die in Händels Partitur enthaltenen Emotionen hervorzuheben, bewahrte aber deren Integrität, indem er kein Material entfernte oder ergänzte. In „Selig, selig, selig Paar!“ hat Mozart die ursprüngliche Streicherbesetzung beibehalten, aber die Oboen gestrichen und die Tuttis durch Flöten und Klarinetten ergänzt. In der Sopranarie „Der König horcht mit stolzem Ohr“ begleiten Flöten und ein Fagott die Geigenmelodie, verstärken die Harmonien und bereichern die inneren Stimmen. In der Tenorarie „Es jauchzen die Krieger voll trunk’ner Wut“ hat Mozart zusätzliche Oboen und Fagotte zur Begleitung der Tuttis verwendet und Imitationen zwischen der ersten und zweiten Violine eingebaut. Mozarts sorgfältige, durchdachte Umarbeitung von Händels Partitur für ein Ensemble, das auch Flöten, Klarinetten und Hörner umfasst, beweist seinen Respekt für den barocken Meister.
Mozarts 1793 uraufgeführte Fassung wurde zur Grundlage für weitere Wiederaufnahmen, darunter Ignaz Franz von Mosels Aufführung an der Winterreitschule in Wien (29. November 1812) unter dem Titel Timotheus oder Die Gewalt der Musik. Außerdem haben Mozarts Händel’sche Bearbeitungen van Swieten wohl dazu angeregt, Joseph Haydn mit der Komposition von Die Schöpfung (1798) und Die Jahreszeiten (1801) zu beauftragen, die beide auf den Libretti des Barons aus englischen Quellen basieren. Van Swietens Händel-Wiederaufnahmen und Haydns Begegnungen mit groß besetzten Aufführungen während seiner Aufenthalte in London führten so zu zwei der größten deutschsprachigen Chorwerke.
Van Swietens Händel-Wiederbelebung begann mehr als fünfzig Jahre, bevor Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 an der Berliner Singakademie Bachs Matthäus-Passion (BWV 244) wieder zum Leben erweckte. Es lässt sich behaupten, ohne van Swieten wären Mozart, Haydn und Ludwig van Beethoven, die drei Komponisten, die als zentrale Vertreter der Wiener Klassik gelten, vielleicht nicht mit den kontrapunktischen Meisterwerken der Barockzeit vertraut gemacht worden. Wäre dies der Fall gewesen, hätte Mozart wahrscheinlich nicht die (unvollendete) Messe c-Moll, KV 427, oder den Schlusssatz seiner Sinfonie C-Dur, KV 551, verfasst, während Beethoven seine Große Fuge B-Dur op. 133 nicht hätte komponieren können.
Daniel Floyd, 1974 geboren, hat als Musik-, Wirtschafts- und Tageszeitungsjournalist gearbeitet. Er promovierte 2008 an der Universität in Aberdeen im Bereich der englischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts und erforschte dabei, wie sich Wertehierarchien entwickeln. Er betrachtet den „Kanon“ der klassischen Musik eher als eine beschreibende denn als eine vorschreibende Grundlage, um Musik zu erkunden und eine fundierte persönliche Auswahl zu treffen. Sein Interesse an der Oper konzentriert sich unter anderem auf den italienischen und deutschen Barock, die Wiener Klassik und die Frühromantik. Seine größte Opernliebe gilt Mozart, dessen außerordentlicher Sinn für Struktur, Modulation und dramatische Intensität in jedem Bühnenwerk von Die Schuldigkeit des ersten Gebots (1767) bis Die Zauberflöte (1791) durchweg verzaubert.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 219-224
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe