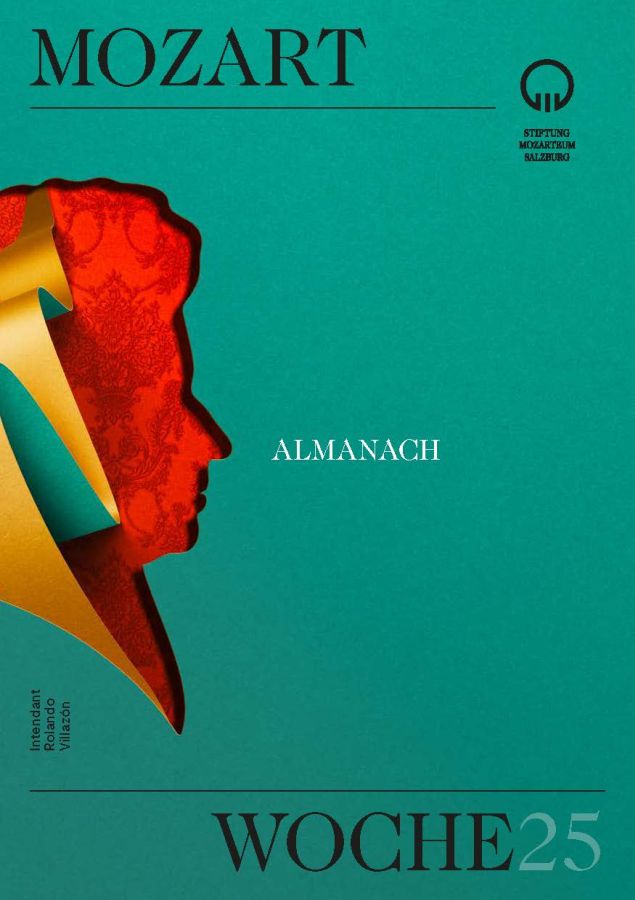- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 272-275
Die Neuinszenierung
Text: Philippe Brunner
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 272-275 [Programmheft]
MOZART
La finta giardiniera KV 196 – Gedanken zur Neuinszenierung der Gärtnerin aus Liebe
Zwei historische Ereignisse geben uns für die Wiederaufnahme der Gärtnerin aus Liebe einen Rahmen vor: einerseits das 250-jährige Jubiläum von Mozarts Oper La finta giardiniera KV 196, deren Premiere am 13. Jänner 1775 im Münchner Salvatortheater stattfand, andererseits die Entstehung dieser Produktion für die Mozartwoche im Salzburger Marionettentheater vor 50 Jahren.
Als sich das Marionettentheater entschloss, eine Inszenierung der Gärtnerin aus Liebe auf die Bühne zu bringen, war es nicht die erste Umsetzung dieser Oper mit den Salzburger Marionetten: Bereits 1948 entstand eine Version der deutschen Singspielfassung mit musikalischen Kürzungen und textlichen Adaptionen von Wilhelm Hoyer, zu der Bühnenbildner Heinz-Bruno Gallé und Bildhauer Josef Magnus die Ausstattung beisteuerten. Schlussendlich galten die damals erfolgreichen Aufführungen im In- und Ausland als ein erster Beweis dafür, dass die Salzburger Marionetten einen großen Opernabend zu tragen vermochten.
Da lag es auf der Hand, dass man sich ein Vierteljahrhundert später wieder an eine Neuinterpretation des Werks machte, nachdem das Theater in der Zwischenzeit mit der Umsetzung der Zauberflöte, der Entführung aus dem Serail, von Bastien und Bastienne, Apollo und Hyancinth sowie Don Giovanni viel Erfahrung gesammelt hatte und sich ein Renommee mit Mozart-Opern auf der Marionettenbühne erarbeiten konnte. (Der Kanon sollte dann in späteren Jahren mit Le nozze di Figaro und Così fan tutte seine Komplettierung erfahren.)
In der Zwischenzeit lag auch eine Tonaufnahme der deutschen Singspielfassung der Finta giardiniera unter Leitung von Hans Schmidt-Isserstedt vor, die mit damals noch jungen, aber heute illustren Sängernamen wie Jessye Norman, Helen Donath, Tatiana Troyanos, Ileana Cotrubas, Hermann Prey u. a. glänzen konnte und als Basis für die Aufführungen diente. In der Inszenierung des kürzlich verstorbenen Regisseurs Klaus Gmeiner (1932–2024) entstand eine Produktion, die das Werk näher an Figaro und Così heranrückte und diesem „Irrgarten der Gefühle“, welcher in Mozarts Jugendwerk vorzufinden ist, auch mehr Glaubwürdigkeit verlieh.
Was diese Umsetzung von 1976 aber so besonders macht, ist die gesamte Ausstattung der Bühne und der Marionetten. Die Kostüme von Marie-Luise Walek sowie das Bühnenbild von Günther Schneider-Siemssen sind an die großartigen Gemälde von Antoine Watteau aus dem frühen 18. Jahrhundert angelehnt und entfachen eine bildlich bestechende Atmosphäre, in der dieses Werk mit all seiner Hintergründigkeit eingebettet ist.
Günther Schneider-Siemssen, der zwischen 1952 und 1991 sämtliche Produktionen des Salzburger Marionettentheaters ausstattete, war bereits damals ein gefragter Bühnenbildner, der für die wichtigsten Theater und Opernhäuser arbeitete und sich nicht zuletzt als „Karajans Bühnenbildner“ einen großen Namen machte. Dennoch sah er in der zauberhaften und kostbaren Welt des Salzburger Marionettentheaters einen großen Vorteil, denn er konnte die kleine Bühne als Modell und Blaupause für seine künstlerischen und technischen Ideen benutzen. So entwarf er zum Beispiel für die Gärtnerin ein sogenanntes „Wandelpanorama“ – einen viele Meter langen, bemalten Gobelintüll, der Verwandlungen auf offener Bühne von links nach rechts (und umgekehrt) erlaubt und somit Zwischenvorhänge für Umbauten zwischen den Szenen und Schauplätzen überflüssig macht. In dieser Form war so etwas zum ersten Mal auf der Bühne des Marionettentheaters zu sehen.
Die Vorstellungen der Gärtnerin aus Liebe im Marionettentheater liefen bis Anfang der 1990er-Jahre im Repertoire, auch ich selbst hatte als Jugendlicher noch die Möglichkeit, diese inspirierende Aufführung mehrfach zu besuchen.
Als nun das ,Doppeljubiläum‘ heranrückte, stieß ich bei Rolando Villazón und dem Team der Internationalen Stiftung Mozarteum auf ein offenes Ohr, die Produktion wieder aufzunehmen und nach über 30 Jahren dem Publikum erneut zugänglich zu machen.
Glücklicherweise sind sämtliche Marionetten, Bühnenbilder, Requisiten sowie das Wandelpanorama in gutem Zustand erhalten und ermöglichen uns nach gründlicher Restaurierung und Einbeziehung historischer Quellen, ein Abbild der damaligen Produktion zu gestalten.
Was ist aber mit der musikalischen Mozart-Rezeption in der Zwischenzeit geschehen? Durch die Erfahrungen und Errungenschaften der historischen Aufführungspraxis, sowie durch ein viel tieferes Ausloten und Beleuchten innerer Seelenzustände in den einzelnen Rollen, erscheinen uns damals verwendete Tonaufnahmen etwas antiquiert, behäbiger und konventioneller in ihrer Ausgestaltung. Für eine Neuinszenierung im Marionettentheater hielten wir es daher für essentiell, das Werk auf ein neues musikalisches Fundament zu stellen, welches die Figuren in ihrer Vielschichtigkeit klarer darstellt und uns Mozarts Werk in einer musikalischen Frische präsentiert, die einer Aufführung mit Marionetten gerechter wird. Diese Grundlage haben wir in der Aufnahme unter der Leitung von René Jacobs gefunden.
In den letzten Jahren konnte sich das Marionettentheater während der Mozartwoche mit unterschiedlichen Produktionen präsentieren, die stets ,liveʻ von Musikern und Sängern begleitet wurden. Um diesen schönen Aspekt beizubehalten, haben wir uns dazu entschlossen, die neu geschriebenen Dialoge (anstelle von Rezitativen) von Studierenden der Schauspielabteilung der Universität Mozarteum während der Aufführungen ,liveʻ (auf Deutsch) sprechen zu lassen. Die diesen Aufführungen musikalisch zugrunde liegende italienische Aufnahme der Finta giardiniera wird durch den so kreierten Singspielcharakter für unser Publikum greifbarer und zugänglicher.
Auch in der Inszenierung suchen wir nach einem neuen Zugang: die psychologische Dichte, das Nebeneinander zwischen Buffo- und Seria-Stil, das Verwirrspiel wie später im Figaro, die vielschichtige Gestaltung der einzelnen Charaktere, die fast schon Rossini-artigen Finali – diese mannigfaltige Grundlage soll uns Ansporn sein und begreifbar machen, das Jugendwerk Mozarts als bemerkenswerten Vorläufer zu sehen, der auf gerader Linie zu szenischen Meisterwerken seiner späteren Jahre führen sollte.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 272-275
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe