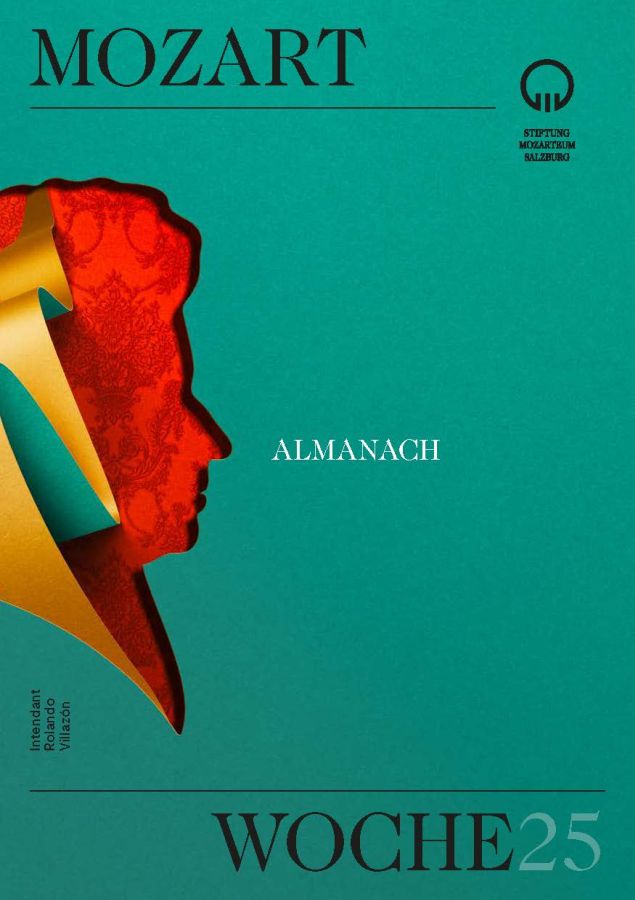- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 282-286
Das Werk
Text: Walter Weidringer
In: Almanach, Mozartwoche 2025, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 282-286 [Programmheft]
MOZART
Die Gärtnerin aus Liebe (La finta giardiniera) KV 196
Was bisher geschah: Am Anfang stand ein unbegründeter Eiferfsuchtsanfall. Der Graf Belfiore wähnte seine Geliebte untreu, die Marchesa Violante Onesti. Der Tathergang kann wohl nie mehr völlig aufgeklärt werden, gesichert sind jedenfalls ein Zornesausbruch auf seiner Seite sowie eine Verwundung durch seinen Dolch, und Ohnmacht auf ihrer. Heute würde ein solches Verhalten eindeutig als „Red flag“ gelten, also ein Anzeichen für eine toxische Beziehung, die man als bedrohter Teil auf jeden Fall beenden sollte. Die Opernbühne des 18. Jahrhunderts bildete jedoch noch andere Bewertungssysteme gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Verhaltens ab – und die Charaktere einer Opera seria oder Opera buffa sind vielleicht lernfähiger als reale Menschen.
Nicht völlig ausgeschlossen ist freilich, dass die eigentliche Verletzung Violantes nicht in voller Absicht geschah und dem aufbrausenden Liebhaber eine Tötungsabsicht fern lag – wollen wir es für sein eigenes Seelenheil und die Beziehung der beiden hoffen. Apropos Seelenheil: Um dieses scheint es vorläufig jedenfalls schlecht bestellt, der Graf bildet sich nämlich ein, seine Geliebte getötet zu haben – und flieht in Panik. Als die clevere Violante wieder zu sich kommt, beschließt sie jedoch, unterzutauchen: Zusammen mit ihrem Diener Roberto nimmt sie eine falsche Identität an. Die beiden finden als Cousine und Cousin unter den Namen Sandrina und Nardo Arbeit im Hause des Podestà (Bürgermeister) Don Anchise, auf dessen Anwesen am Lagonero (Schwarzensee): Sandrina ist nun „La finta giardiniera“, gibt sich also als Gärtnerin aus …
Die barocke Opera seria hatte sich zu einer relativ starren Gattung entwickelt: Reißbrettartig angeordnete, schematisierte Charaktere offenbarten ihre Gefühle in einer nur ausnahmsweise durchbrochenen Kette von Arien, während die verbindenden Rezitative der Vorantreibung der Handlung in Dialogform dienten. Doch auch die um 1740 entstandene Opera buffa landete bald in typisierten Figuren, Konstellationen und Verwicklungen – ein Phänomen, das bis heute jene Geschichten prägt, die wir uns etwa auf der großen Leinwand sowie auf Bildschirmen mittlerer bis ganz geringer Größe erzählen lassen, in „RomComs“, „Soap Operas“ und anderen Filmen und Serien. „Mit dem Rückgriff auf die Rollentypologie der Commedia dell’arte“, so schreibt Silke Leopold mit Verweis auf den einflussreichsten Komödien- und Librettodichter jener Zeit, „sicherte Carlo Goldoni die Lebensfähigkeit der komischen Oper, indem er neben die komischen Rollen, die Tölpel und Spinner, die gewitzten Kammerzofen und Diener, nun auch ‚ernste‘ Personen nach Art der ‚Innamorati‘, der verliebten jungen Paare, und solche Rollen stellte, die als ‚mezzo carattere‘ sowohl ernst als auch komisch waren.“
Das anonym überlieferte, meist Giuseppe Petrosellini zugeschriebene Libretto von La finta giardiniera hatte bereits 1774 eine Vertonung von Pasquale Anfossi für den römischen Karneval erlebt, bevor der 18-jährige Wolfgang Amadé Mozart vermutlich vom Münchner Intendanten Joseph Anton von Seeau, einem gebürtigen Linzer, den Auftrag erhielt, es neu zu komponieren. Die Uraufführung fand am 13. Jänner 1775 in München statt, Kurfürst Maximilian III. Joseph beehrte die Vorstellung mit seiner Anwesenheit.
Was diese Vorlage an dramatischer Stringenz vermissen lässt, macht sie wett durch die nahezu lehrbuchartige Figurenkonstellation, bei der sich das Publikum ganz zuhause fühlen konnte. Im typusbedingt einsamen Zentrum steht Don Anchise, der Podestà (Tenor): Dieser ältere Mann, der justament auf Freiersfüßen wandeln will und sich in die schöne neue Gärtnerin Sandrina verliebt, entspricht dem Pantalone der Commedia dell’arte, der in unzähligen Opern sein Fett abkriegt und schließlich Verzicht übt. So auch hier: Am Ende resigniert er in seiner als vergeblich erkannten Zuneigung zur Gärtnerin. Zu den Verwicklungen tragen noch zwei weitere Figuren bei: Arminda, Don Anchises snobistische Nichte (Sopran), und der triste Ritter Ramiro (ebenfalls Sopran), der sich in vergeblicher Liebe zu ihr verzehrt. Sie treten in „parti serie“ auf, sind also als ernste Charaktere von Stand gezeichnet – worauf auch die Uraufführungsbesetzung des Ramiro mit einem Kastraten hindeutet, einem Stimmtypus, der eindeutig der Opera seria angehört. Verwickelt wird es, weil eben diese Arminda dem Ramiro den Laufpass gegeben und sich stattdessen Belfiore zum Verlobten erkoren hat, und weil Ramiro in Lagonero auf andere Gedanken kommen wollte und keine Ahnung hatte, dass Arminda als Nichte des Podestà ebenfalls – und samt Ehemann in spe! – dort auftauchen würde.
Belfiore und Violante, die sich unter diesen ungeahnten Umständen wiedertreffen, er als nur halbherzig in die neue Beziehung involvierter Bräutigam, sie in der Verkleidung als Gärtnerin Sandrina, sind „mezzo caratteri“, also für ernste und auch komische Facetten zuständig. Komplettiert wird das Personal durch die beiden Dienerfiguren Roberto (Nardo) und Serpetta, die Wirtschafterin des Podestà: Die will längere Zeit nichts von Robertos Zuneigung wissen, weil sie sich noch Hoffnungen auf ihren Herrn macht, aber am Ende werden auch diese beiden ein Paar auf standesgemäßer Augenhöhe – und machen als „parti buffe“ die Besetzung komplett.
Mozarts Musik gibt einen faszinierenden Einblick in seinen Entwicklungsstand und lässt auch jenen Feuereifer spüren, der ihn befiel, weil er nach drei Jahren Pause wieder einmal mit einer Oper zu tun hatte. Tatsächlich lässt La finta giardiniera, ein gutes Jahrzehnt vor Le nozze di Figaro entstanden, inmitten von tadellosen Erfüllungen zeitgenössischer Erwartungen bereits die dort zur Perfektion gebrachten Stilmittel erahnen. Die Arien weisen viele verschiedene, den Charakteren und der jeweiligen Situation genau angepasste Formen auf. Besonders einprägsam sind dabei die Instrumentenarie des Podestà (Nr. 3), in der verschiedene Instrumente des Orchesters mit solistischen Einwürfen Facetten seines Gemütszustandes widerspiegeln, oder Nardos polyglotte Arie (Nr. 14), in der er Serpetta mit italienischen, französischen und englischen Stilelementen beeindrucken will. Verkörpern Arminda und Ramiro daneben auch musikalisch die ältere, strenge Opera seria, ist vor allem die angebliche „Gärtnerin“ mit jener Mischung aus nobler Empfindung und Anmut, Gefühlsernst und Schalk im Nacken ausgestattet, die schon an Susanna & Co. denken lässt. Auffällig sind auch das Gespür für die Übersetzung der theatralen Dramaturgie in eine musikalisch-dramatische Abfolge in Gestalt der zwei großen Ketten- Finali, die die ersten beiden Akte beenden. Wie Tempo und Takt, Tonartenverhältnisse und Duktus der Musik hier den Verlauf gliedern und zugleich zu einem durchgehenden Ganzen machen, muss als ergiebiges Trainingslager für die Trias der Da Ponte-Opern angesehen werden.
„Gottlob!“, schrieb Mozart seiner Mutter am 14. Jänner 1775 nach Salzburg: „Meine opera ist gestern als den 13ten in scena gangen; und so gut ausgefallen, daß ich der Mama den lärmen ohnmöglich beschreiben kan. Erstens war das ganze theater so gestrozt voll, daß vielle leüte wieder zurück haben müssen. Nach einer jeden Aria war alzeit ein erschröckliches getös mit glatschen, und viva Maestro schreÿen. S: Durchlaucht die Churfürstin, und die verwitwete, (welche mir vis à vis waren) sagten mir auch bravo. Wie die opera aus war, so ist unter der zeit wo man still ist, bis der ballet anfängt, nichts als geglatscht und bravo geschrÿen worden; bald aufgehört, wieder angefangen, und so fort. Nach dem bin ich mit meinen papa in ein gewisses Zimmer gangen, wo der Churfürst und der ganze hof durch Muß und hab s: d: den Churfürste und Churfürstin und den hoheiten die händ geküst, welche alle sehr gnädig waren. heünt in aller frühe schickt S: fürstlichgnaden bischof in Chiemsee her, und läst mir gratuliren, daß die oper beÿ allen so unvergleichlich ausgefallen ist.“
Der Musiker, Dichter und Journalist Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791) hat die Premiere oder eine der trotz des großen Erfolgs nur zwei Folgeaufführungen miterlebt: „Auch eine Opera buffa habe ich gehört von dem wunderbaren Genie Mozart. Sie heißt La finta Giardiniera. Genieflammen zucken da und dort, aber es ist noch nicht das stille, ruhige Altarfeuer, das in Weihrauchwolken gen Himmel steigt. Wenn Mozart nicht eine im Gewächshaus getriebene Pflanze ist, so muß er einer der größten Komponisten werden, die jemals gelebt haben.“
Walter Weidringer, geboren 1971 in Ried im Innkreis und in Gunskirchen aufgewachsen, studierte in Wien Musikwissenschaft, Philosophie, Theaterwissenschaft und Geschichte (Diplomarbeit: Sex, Lügen und Videos. Zu Fragen nach narrativen Strategien, Interpretation und Autorschaft am Beispiel „The Turn of the Screw“). Er war Lehrbeauftragter am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien, ist seit 1999 Musikkritiker der Tageszeitung Die Presse und schreibt u. a. auch für Opernwelt und Opern.News. Seit 2020 gestaltet er regelmäßig Radiosendungen für den ORF-Sender Ö1 (Vorgestellt, Zeit-Ton etc.). Als freier Musikpublizist verfasst er Programmhefttexte, hält Einführungen, produziert Rundfunkbeiträge und moderiert Diskussionen für zahlreiche Konzertveranstalter, Festivals, Plattenlabels und Sendeanstalten, war auch wissenschaftlich tätig (etwa für die Neue MGG) sowie als Dramaturg und Programmberater (Berlioz-Tag beim Festival Grafenegg 2011; Schubertiade der Wiener Symphoniker 2015). Außerdem absolviert er gelegentlich künstlerische Auftritte (2006 Debüt im Wiener Musikverein).
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2025
- S. 282-286
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe