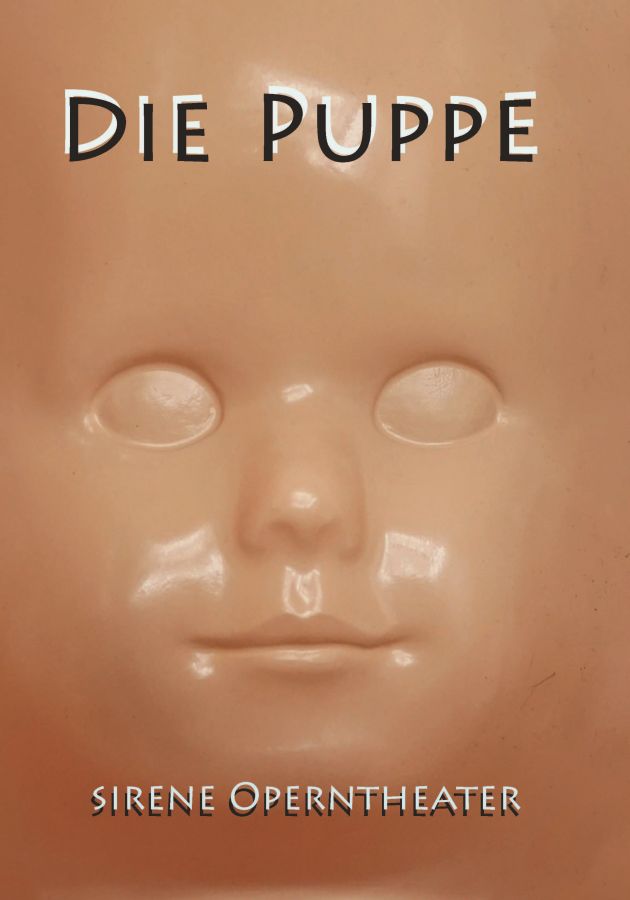- Die Puppe
- Sirene Operntheater
- Ein Operoid - 1. bis 7. November 2024
- S. 41-60
Eins sein mit allem was tickt
Bewegungskontrolle und Zeitdisziplin
Text: Ernst Strouhal
In: Die Puppe, Ein Operoid - 1. bis 7. November 2024, Sirene Operntheater, S. 41-60 [Programmheft]
I
Kurz nach Haydns Tod Ende Mai 1809 erschien in Wien die anonyme Schrift „Traditionen zur Charakteristik Österreichs, seines Staats- und Volkslebens unter Franz dem Ersten“. In klagendem bis anklagendem Ton heißt es:
„Haydn starb und kaum hörte man hin. Der Mechaniker Mälzel, der seinen Trompeter auf dem Balkon des Schönbrunner Schlosses hatte blasen lassen und mit dessen Schachspieler der Universalkaiser sich auf einen Zweikampf eingelassen, überragte jetzt alle Tonsetzer des neuen, alle Magier des mittleren Zeitalters.“ 1
Die kurze Feststellung, die Erwähnung von Haydns Tod und Mälzels Erfolgen ist nur scheinbar neutral. Eher ist sie kritisch gegenüber den Erfolgen dieses Mälzels zu lesen, kritisch einem neuen Zeitalter gegenüber, in der die mechanischen Schachspieler und Trompeter die menschlichen Tonsetzer überragen. Oder vielleicht sogar ersetzen.
Johann Nepomuk Mälzel stammte aus Regensburg und war von München zu Beginn des Jahrhunderts nach Wien gekommen. Er war Musiker, vor allem aber gut verdienender Prothesenmacher und Herr über ein ganzes Ensemble von Automaten, ein gut sortierter, spektakulärer Maschinenpark, der zur Unterhaltung und „genussreichen Bildung“ diente: Der erwähnte Trompeter, eine mechanische Seiltänzerin, ein Panharmonicon, ein mechanisches Orchester, für das Beethoven vier Jahre später die Ouvertüre opus 91 komponieren wird, ein riesiges Diorama und der ebenfalls erwähnte automatische Schachspieler gehörten dazu. Ob sich Mälzel bereits in Wien mit dem Metronom beschäftigte, ist bis heute unklar, aber ob Automaten oder menschliche Spieler: Mälzel brachte ihre Bewegungen in den richtigen Takt.
Der Titel meines Beitrages ist eine Paraphrase auf Friedrich Hölderlins berühmten programmatischen Satz: „Eins sein mit allem was lebt“, den er seinem Hyperion, dem Helden seines gleichnamigen Briefromans aus 1797, voll Emphase ausrufen lässt. „Eins sein mit allem was lebt“ ist der Ausdruck der Sehnsucht des Idealismus, dass der Mensch „in seliger Selbstvergessenheit“ aufgehe in der Natur, dass er seine Position außerhalb der Natur aufgebe und die irreversiblen Schäden der Modernisierung widerrufbar wären.
Es gibt freilich auch eine andere, antivitalistische Tradition, welche den Menschen in Analogien zum technischen Gerät fasst und seine Subjektivität dämpft; im mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts ist der Mensch eine Maschine, eine bessere Uhr, die tickt und am Ende zerbricht. So etwas wie eine Seele gibt es nicht, sie ist nur Bewegung, die, wiewohl rätselhaft in ihrem Zweck, letztlich Regeln folgt und also kontrollierbar ist. Die Bewegungskontrolle ist auch und vor allem die Kontrolle über die Zeit, in der die Bewegung erfolgt.
Die materialistische Gegengeschichte des „Eins seins mit allem was tickt“ ist alt. Technisch beginnt sie im Mittelalter in Europa und China mit der Konstruktion der ersten Turmuhren, also der Schaffung von distinkten Bewegungsformen und ihrer Kontrolle durch Sperrvorrichtungen wie dem Anker oder Haken; sie hemmen die Drehung des Zahnrades und verwandeln fließende in ruckartige Bewegungen, durch die regelmäßigen Unterbrechungen wird der Bewegungsfluss in gleichmäßige, zählbare (digitale) Schritte segmentiert. Alle Automaten basieren auf diesem Prinzip der Kontrolle. Die Uhr ist dabei nicht bloß ein Symbol unter vielen, sondern wird zur Zentralmetapher für Leistung, Effizienz und Rationalität, aber auch für Gehorsam und für Gerechtigkeit.
Die auf diesem Prinzip beruhenden Spiel-, Schreib- und Musikautomaten des 18. Jahrhunderts materialisieren eine Erfahrung, die bis heute zu beunruhigen vermag und Angstlust beim Betrachter verbreitet. Die Automaten und Androiden faszinieren gleichermaßen wie sie uns erschrecken. Sie sind lesbar als Ausdruck einer neuen „politischen Ökonomie des Körpers“ (Michel Foucault), die bis in die hintersten Winkel des privaten Lebens, ja in den menschlichen Körper hinein reicht. Sie ist die spielerische Propädeutik oder Begleitmusik der Industrialisierung der Güterproduktion, in der die Mechanisierung und Maschinisierung zum Alltag werden wird. Eine neue Kultur der technischen Rationalität setzt an, das Leben zu beherrschen.
Entlang der Rezeptionsgeschichte eines besonderen Automaten eines Zeitgenossens Haydns, des mechanischen Schachspielers von Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804), werde ich versuchen, diese Entwicklung und mentalitätshistorischen Bruchlinien in der Etablierung dieser neuen Kultur zur Haydnzeit zu skizzieren. Kempelens Schachspieler eignet sich dazu besonders, im Gegensatz zu den Musikautomaten seiner Zeit spielt ein neues, ein besonderes Lied: das Lied der Vernunft.
II
28 Jahre vor Haydns Tod, im Herbst 1781, trafen Großfürst Paul, der erstgeborene Sohn von Katharina der Großen, und dessen Gemahlin Maria Feodorowa zu einem fünfwöchigen Besuch in Wien ein. Das Ceremonialprotokoll verweist auf Besuche der Kasernen am Heumarkt und des Hetzhauses, zugleich standen Musikstunden mit Joseph Haydn, der dem Paar die Jungfernquartette opus 33 widmete, und die Besichtigungen des Schachautomaten von Kempelen auf dem Programm.
Kempelen war wie Haydn Mitglied der Loge Zur wahren Eintracht und gehörte der Generation der aufgeklärten Beamten Maria Theresias an. Von den vielen bescheidenen Spuren, die Wolfgang von Kempelen in der Wissenschafts-, Verwaltungs- und Kulturgeschichte hinterlassen hat, ist der Schachautomat, den Großfürst Paul und seine Gemahlin 1781 besichtigten, die deutlichste und zugleich die vieldeutigste geblieben.
Abgesehen von der langen, sich über fast 70 Jahre erstreckenden Spielzeit unterscheidet sich seine äußere Biographie nur wenig von der anderer Unterhaltungsautomaten seiner Zeit. Dennoch wird seine Geschichte wieder und wieder erzählt, über keinen Automaten des 18. Jahrhunderts wurde annähernd so viel publiziert.2 Bereits seit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts wird er stets mit dem Attribut „berühmt“ bedacht. Trotz der im Grunde sporadischen Auftritte Kempelens zu Lebzeiten gehörte die schachspielende Puppe zu dem, was man eine mediale Sensation nennen könnte. Dabei war schon im Todesjahr Kempelens 1804 evident, und Kempelen hatte selbst nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sich im Gegensatz zu den Vaucansonschen, Jaquet-Drozschen und Knausschen Automaten bei der Konstruktion um einen Pseudoautomaten, um eine „Täuschung“ handelte. In der Apparatur war ein Mensch verborgen.
Zwischen 1770 und 1800 bot Kempelens Pseudoautomat wie kein anderer Gegenstand der Publizistik der Spätaufklärung Anlass zu Spekulationen philosophischer und technischer Natur, zur Bewunderung des mechanischen Genies seines Schöpfers gleichermaßen wie zur heftigen Kritik an der Taschenspielerei und sogar am versuchten Betrug am Volk. Die Androiden des 18. Jahrhunderts, zu denen Kempelens Schachspieler gehört, repräsentieren auf spielerische Weise eine neue, nach Affektkontrolle und Effizienz strebende Lebensform. In ganz besonderer Weise gilt dies für Kempelens Automat: Er hat das Schachspiel erlernt, das seit dem Mittelalter als Allegorie zweckrationalen Handelns und instrumenteller Vernunft gilt, zum anderen, und dies unterscheidet ihn von den anderen Automatenfiguren seiner Zeit, stellt der Türke, indem ein Mensch in der Maschine verborgen ist, selbst bereits die Parodie avant la lettre auf diese im Entstehen befindliche Kultur technischer Rationalität dar.
Durch diese Ambivalenz erweist sich Kempelens Pseudoautomat, der aufgrund seiner orientalischen Tracht häufig „Türke“ genannt wird, bis heute als überaus flexible Metaphernmaschine. Sie ist in der Lage, allegorische Strukturen zu erzeugen, deren Elemente ständig neu codiert, kombiniert und aktualisiert werden können: Über die Türkenfigur kann das Motiv der Identität zwischen Mensch und Maschine (und die Sehnsucht nach einer Differenz) abgearbeitet werden, von der Hybris des Automatenbauers, von den Grenzen der Simulation und zugleich vom Sieg des Gauklers über eine fortschrittsgläubige, durch das Glücksversprechen der Technik blind gewordene Öffentlichkeit erzählt werden.3
Die erste Vorführung des „Türken“ hat wohl in der zweiten Hälfte des Jahres 1769 stattgefunden. Gedacht war der Automat für das private oder halböffentliche Amüsement Maria Theresias, die – der Mode ihrer Zeit folgend – Gefallen an unterhaltsamen wissenschaftlichen und technischen Vorführungen fand. Im „Extra-Blatt“ des wöchentlich erscheinenden „Brünner Intelligenz-Zettels“ vom 24. August 1769 findet sich die folgende Meldung über eine (die erste?) Präsentation des Schachautomaten:
„Ein ungarischer Hofcammerrath, Namens von Kempelen, hat kürzlich ein künstliches Uhrwerk erfunden, dessen sinnreicher Bau oder Zusammensetzung nicht nur das Ansehen der neubegierigen Liebhaber verdienet, sondern auch ihre Einbildungskraft bey Untersuchung der darinn verborgen liegenden Kunst ungemein beschäftiget. Er hat eine Maschine, so einen Türken in Lebensgröße repraesentiret, stehend bey Hofe dargestellet. Dieser Türke antwortet auf verschiedene an ihn gerichtete Fragen, löset die schweresten arithmetischen Problemata auf, indem er die ihm vorgelegten Buchstaben und Ziffers aussuchet und zusammensetzet, und was das wundernswürdigste ist, spielet er mit jedem Zuschauer Schach. Die türkische Figur beweget sich mit Kopf und Händen, zieht, und macht alles Nothwendige beym Spiel selbst, wie ein anderer Spieler. Man hat dabey bemerket, daß, wann jemand falsch spielet, oder seine Desseins ändern will, es die Maschine sogleich wahrnihmt, und seinen Gegner durch Zeichen corrigiret. Es haben die höchsten jungen Herrschaften beynahe alle, wie auch andere hohe Nobleße mit dieser Maschine gespielet. Der Kaiserin Maj. haben dem Herrn von Kempelen eine goldene Dose mit 1000 Ducaten zur Belohnung gegeben, und es wird dieses Kunststück, wenn selbiges genau beschrieben und gedruckt ist, in das kais. Kunst=Cabinet gebracht werden.“
Alle Akkorde sind hier bereits angeschlagen, die sich als Motive und Themen in den vielen späteren Beschreibungen über den „Türken“ finden werden. In diesem frühen Bericht besteht noch kein Zweifel daran, dass es sich bei der Maschine nur um ein „künstliches Uhrwerk“ handeln müsse. Der Verfasser appelliert an das interessierte Publikum, der „verborgen liegenden Kunst“ des Apparates nachzugehen und geht hellsichtig davon aus, dass dieses Geheimnis die „Einbildungskraft“ der „neubegierigen Liebhaber“ noch lange beschäftigen würde. Der Berichterstatter geht auch recht genau auf die Funktionsweise des Automaten ein, der Kopf und Hände zu steuern vermochte. Kempelen hatte geschickt einige wenige typisch menschliche Bewegungen ausgewählt und mechanisch imitiert. Ein leichtes Nicken des Kopfes oder auch die Bewegung eines Arms stellte offenbar das geeignete pars pro toto dar, um beim Publikum jene Illusion von Lebendigkeit zu erzeugen, die nach wie vor an den Androidenfiguren fasziniert.4
Der Automat bestand aus einem mehrteiligen Holzkasten, an dessen Rückwand eine menschengroße Puppe mit überkreuzten Beinen saß. Die hinter dem Kasten sitzende Puppe trug orientalische (türkische) Tracht, wodurch der Ausdruck „getürkt“ oder „einen Türken bauen“ häufig in Zusammenhang mit Kempelens Figur gebracht wurde. Technisch gesehen gründete der Erfolg des Kempelenschen Schachspielers auf der gelungenen Kombination von drei Faktoren: dem Versteck des Spielers im Kasten, der präzisen Mechanik der Lenkung des Spielarms und der Anwendung des Magnetismus bei der Informationsübertragung der Züge vom Schachbrett zu dem im Inneren verborgenen Spieler.
Der „Türke“ war eine eklektizistische Maschine, Kempelen verwendete bei seiner Konstruktion im einzelnen bekannte Elemente aus den Bereichen der Zauberkunst, der Geometrie und der experimentellen Physik. Er kombinierte sie jedoch zu einem neuen Ganzen und versah sie mit einer neuen intellektuellen Tätigkeit, dem Schachspiel; dadurch bot er dem Publikum Gelegenheit zu schwärmerischen Interpretationen über die „Zauberkräfte der Natur“ und den menschlichen Geist wie über die Möglichkeiten und Grenzen der Technik.5 War es tatsächlich möglich, dass eine Maschine das schwierigste aller bekannten Spiele autonom spielen konnte?
Idiosynkrasie und Erfolg des „Türken“ sind jedoch nicht allein aus der Maschinentechnik erklärbar. Sie betreffen sein Betätigungsfeld, das Schachspiel, und die Person seines Präsentators: In gewisser Weise stellte sich Kempelen während der Vorführungen selber aus. Er war weder professioneller Zauberkünstler noch vazierender wissenschaftlicher Experimentator, sondern als hoher Beamter im Stab der Kaiserin bekannt und als solcher angekündigt. Die Erwähnung der Ehrwürdigkeit und Bescheidenheit des Konstrukteurs, seiner Höflichkeit und galanten Manieren, bildeten einen wichtigen Topos in der frühen Rezeption des Schachspielers im 18. Jahrhundert.6 Der Baron erscheint dem Publikum auf Grund seines Auftretens „nichts weniger als ein Charlatan, sondern räsoniert recht angenehm über die Mechanik seiner Maschinen“, wie es in Elise von Reckes Bericht von einer Vorführung in Leipzig heißt.7
Das „angenehme Räsonieren über Mechanik“, das Einhalten des Kodexes höfischen Benehmens, erweist den „Türken“ noch als zugehörig zu einer höfisch galanten Öffentlichkeit des Ancien Régime, deren Interesse sich weniger an Erkenntnis als am Unterhaltungswert der Technik entzündete. Die Automaten und ihre Mechanik blieben ein Thema, solange der Erfinder „recht angenehm“ darüber zu räsonieren verstand.
Zur Erzeugung der Illusion einer schachspielenden Maschine wurden sowohl Geräusche als auch visuelle Eindrücke aller Art mobilisiert. Mehrfach wurde die Maschine während der Partie aufgezogen, das Rattern und Ächzen der Scheinmechanik verstärkte das Bild der autonom agierenden Puppe. Vom Maschinentheater Tendlers oder von den mechanischen Orchestern Mälzels unterschied sich der „Türke“, da durch sein Spiel die Trennung von Rezipient und Produzent überwunden wurde. Das Publikum spielte während der Schachpartie mit, die Maschine agierte nicht bloß, sondern reagierte auf Aktionen aus dem Publikum. Im modernen Begriff enthielt Kempelens Präsentation daher sowohl multimediale als auch interaktive Elemente.
Das aktive Einbeziehen des Publikums als integrativer Bestandteil oder Höhepunkt der Inszenierung wurde im 18. Jahrhundert natürlich von Zauberkünstlern verwendet, aber auch von wissenschaftlichen Schaustellern und Quacksalbern.8 Die „haarsträubende“ Berührung einer durch eine Elektrisiermaschine mit kinetischer Energie aufgeladenen Dame ist ein häufig abgebildetes Sujet von Technikpräsentationen im bürgerlichen Salon, die „Heilung“ des Patienten, das heißt: die Tortur und öffentliche Zufügung von Schmerz, bildete die Hauptattraktion bei den Medical Shows auf Jahrmärkten. Auch den (menschlichen) Spielern, die gegen den Automat spielten, wurde Schmerz zugefügt. Sie hatten keine Chance, im Körper des „Türken“ spielten die besten Spieler der Zeit.
III
Die Verwendung des Schachspiels für die Tätigkeit eines Automaten erfüllte für Kempelen, den nach Statuserhöhung und gesellschaftlichem Erfolg strebenden Kleinadeligen, eine mehrfache Funktion. Zum einen nahm das Schachspiel in der ludischen Kultur der Residenzstadt Wien eine besondere Stellung ein. Glücks- und Hazardspiele bildeten zur Mitte des 18. Jahrhunderts neben Jagd und Theater ein standesgemäßes Vergnügen des Adels. Es wurde in bürgerlichen Salons, in eigenen Spielclubs, aber auch – nicht zuletzt durch die Passion Maria Theresias – intensiv am Hof betrieben. Da es beim Glücksspiel zumeist um hohe Beträge ging, waren ruinöse Verluste die Folge. Vergebens hatte sich bereits Leopold I. in seiner „Spillens Verbietung“ bemüht, „diesem so wohl unter dem Adel, als anderen eingerissenen Greuel“ durch die Androhung von schweren Strafen ein Ende zu bereiten.9 Joseph II. stand dem Hazard sehr skeptisch gegenüber, dagegen war das Schachspiel in der adeligen und in der bürgerlichen Gesellschaft stets als „königliches“ Spiel valorisiert und von staatlichen und religiösen Verboten ausgenommen.
Indem das Schachspiel von seinem sozialen Status her eine Mittelstellung zwischen Spiel, Wissenschaft und Kunst einnahm und sogar von pädagogischem Wert schien, riskierte der Hofsekretär Kempelen mit der Wahl für die Tätigkeit seines Automaten, der ja zunächst für die Unterhaltung am Hof gedacht war, nichts. Die Wahl des Schachspiels hatte noch zwei weitere Funktionen: Sie unterschied den Türken von anderen Spielautomaten seiner Zeit und evozierte die alten Metaphernschichten des Schachspiels als Allegorie der Courtoisie, der Circumstatio und Affektkontrolle durch Vernunft.
Während Vaucansons Ente gackerte, mit den Flügeln schlug und tierischen Stoffwechsel vortäuschte und die Künstlerandroiden von Jaquet-Droz nur Vorgegebenes reproduzierten, hatte Kempelens Schachspieler scheinbar von der Ratio Besitz ergriffen. Anders als der zwar zur Verdauung fähige, aber sprach- und bewusstlose cartesianische Tierautomat und anders als die reproduzierenden Künstler simulierte der „Türke“, indem er das Schachspiel erlernt hatte, die Mechanik des freien menschlichen Geistes. Funktionierte sein Automat tatsächlich autonom, dann wäre er die „wunderbarste, über jedwede Vergleichung turmhoch erhabene Erfindung der Menschheit“, wie Edgar Allan Poe 1836, allerdings lakonisch, bemerken wird.10
IV
Ein schachspielender Mechanismus wie der Kempelens vereint die Metaphern des Uhrwerks und Schachspiels. Beides sind Modelle der Welt und Projektionsflächen für das menschliche Selbst, Modelle des Ordnungswillens, des Gehorsams und der Herrschaft: Die Schachfiguren gehorchen dem, der die Macht hat, sie zu ziehen; die Uhr dem, der die Macht hat sie aufzuziehen. Was die Uhr als materiale Maschinenmetapher zur Erklärung der Körperfunktionen leistet, leistet das Schachspiel als immaterielle Maschine für den menschlichen Geist.
Seit ihrer Erfindung diente die Räderuhr als Welt- und Körperbild, von Comenius bis Descartes als Beweis für die Existenz Gottes und der unsterblichen Seele.11 Im mechanischen Materialismus des 18. Jahrhundert dagegen – bei La Mettrie, aber vor allem bei d’Holbach – wird die Uhrwerksmetapher bereits vorzüglich dazu verwendet, um die Existenz Gottes und einer unsterblichen Seele zu verneinen. Natur, Tiere und Menschen erscheinen nun als sich selbst aufziehende Uhrwerke mit unterschiedlicher Komplexität und beschränkter Haltbarkeit.
Im „L’Homme-Machine“ de La Mettries aus dem Jahr 1747 ist der Mensch „nur ein Tier oder eine Gesamtheit von Triebfedern (...), die sich alle gegenseitig aufziehen, ohne daß man sagen könnte, an welchem Punkt des menschlichen Bereiches die Natur damit angefangen hat.“12
Ebenso heißt es im „System der Natur“ 1770 bei d’Holbach: „Man kann das organisch gebaute Wesen mit einer Uhr vergleichen, die sich, einmal zerbrochen, nicht mehr für den Gebrauch, für den sie bestimmt ist, eignet. Sagen, daß die Seele nach dem Tode des Körpers empfinden, denken, genießen, leiden werde, heißt behaupten, daß eine in tausend Stücke zerbrochene Uhr weiterhin schlagen oder die Stunde anzeigen könne. Diejenigen, die uns sagen, daß unsere Seele ungeachtet der Zerstörung des Körpers fortdauern könne, behaupten augenscheinlich, daß sich die Modifikation eines Körpers erhalten könne, nachdem der dazugehörige Gegenstand zerstört ist: was völlig absurd ist.“13
Während die Motivgeschichte von Uhr und Schachspiel im Mittelalter und in der frühen Neuzeit parallel und unabhängig verläuft, begegnen einander Uhr und Schachspiel im Barock häufig.14 Der gelehrte Fürst Herzog August von Braunschweig-Lüneburg (1579-1666) etwa sammelte leidenschaftlich Uhren; ebenso liebte er das Schachspiel. Mehrfach ließ sich Herzog August am Schachbrett portraitieren. 1616 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Gustavus Selenus das „Schach= oder König=Spiel”, das erste gedruckte Schachlehrbuch in deutscher Sprache.15 Das königliche Spiel war Symbol rationaler Machtausübung und politischer Klugheit, an den Uhren faszinierte August die Präzision ihrer Mechanik. Im 17. Jahrhundert häufen sich die Ankäufe von teuren Schachfiguren ebenso wie von automatischen Soldatenfiguren. Ludwig XIV. bestellte 1664 bei Nürnberger Handwerksmeistern für seinen Sohn zwei mechanische Armeen, gleichzeitig standen wie bei den Söhnen Franz I. auch Schachstunden auf dem Stundenplan des Dauphins.16 Im Blick der Barockfürsten sind Uhrwerke und Schachfiguren kleine Automaten, die „wie aufgezogen“ funktionieren und über die vollständige Kontrolle möglich ist.
V
In Kempelens mechanischem Schachspieler treffen nun die beiden Motive von Uhr und Schachspiel zusammen. Indem der Türke sinnlich erfahrbar ist, eignet er sich als dingfester Ausgangspunkt, als Fetisch für philosophische Spekulationen über das Mensch-Maschineverhältnis.
Zwischen der Philosophie des französischen Materialismus und den Automatenbauern im 18. Jahrhundert besteht natürlich kein ostentativer Zusammenhang. Weder Jacques Vaucanson, der ab 1741 Kommissär für die Lyoner Seidenmanufakturen war und Webstühle konstruierte, noch die Schweizer Uhrmacher Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz noch der Beamte Kempelen wollten etwas gemein haben mit einem Ironiker wie de La Mettrie oder einem antiklerikalen Provokateur wie d’Holbach. Die Automatenbauer des 18. Jahrhunderts waren im Unterhaltungsgeschäft tätig, in einem aus heutiger Sicht nur schwer zu bestimmenden Raum zwischen Zauberkunst, dem Verkauf kostbarer Ware und wissenschaftlichem Experiment.
Ihre Produkte, Vaucansons „bête-machine“ ebenso wie die künstlichen Kinder aus der Werkstatt von Jaquet-Droz oder Kempelens „Türke“, können jedoch als die Begleitmusik gesellschaftlicher Disziplinierung, als Vorspiel der neuen Arbeitswelt für das höfische und bürgerliche Publikum im Ancien Régime verstanden werden: Wenn sogar die intellektuelle Arbeit der Schachspieler im mechanischen Experiment nachvollziehbar war, wie leicht könnte es sein, sie bei den bei weitem einfacheren Arbeiten im Alltag, im Staatswesen und in den Fabriken maschinell zu steuern und zu mechanisieren.
Die neuen Techniken der Formierung und Disziplinierung des Körpers in der Arbeitswelt, ein neues zunehmend differenziertes Kontroll- und Organisationswissen vom Menschen in der Wissenschaft und Bürokratie erzeugt eine neue „politische Ökonomie des Körpers“.17 Kempelens Automat erscheint geradezu als Materialisierung dieser neuen Ökonomie: Der Schachspieler ist gelehrig, höflich in den Umgangsformen, in seinen körperlichen wie in seinen geistigen Bewegungen vollständig kontrolliert. Damit entspricht er auch dem Idealbild des Beamten am Hofe Maria Theresias; Kempelen hat mit der Schachmaschine in gewissem Sinn seinen eigenen Doppelgänger geschaffen.
Seine gesamte berufliche Karriere, vor allem seine kommissarische Tätigkeit bei der Impopulation des Banats von 1765 bis 1771, weist Kempelen als loyalen, angepassten Anhänger des Kaiserhauses aus, als geschickten Exekutor der pragmatischen Denk- und Handlungsprinzipien der Theresianischen Aufklärung bei der Lenkung des „Unterthans“ und Zivilisierung des „rauhen, unwissenden Volcks“.18
Als Beamter war Kempelen zur Mitte des 18. Jahrhunderts mit neuen, noch im Fluss befindlichen Strukturen konfrontiert. Ausgelöst wurde ab 1748 eine Welle von politischen Reformen, die in fast allen gesellschaftlichen Bereichen das eher an Funktionalität denn an Grundsätzlichkeit orientierte moderne Verwaltungshandeln der Theresianischen Aufklärung etablierten. Im Vordergrund standen Evidenz, Einfachheit, Klarheit und Gleichförmigkeit. Die Charakteristik Maria Theresias von Friedrich Wilhelm von Haugwitz diente dabei als Leitbild für alle hohen Beamten wie Kempelen: Wie Haugwitz sollte der Beamte „ehrlich, ohne Nebenabsicht, ohne Voreingenommenheit“ sein, einer, der „die größte Uneigennützigkeit mit unerschütterlicher Anhänglichkeit an seinen Landesfürsten, die umfassendste Begabung mit Freude und Fleiß zur Arbeit verbindet, der das Licht nicht scheut und sich noch weniger fürchtet vor dem unrechten Hasse derjenigen, die durch ihn ihre Privatinteressen gefährdet glauben.“19
Die Bedeutung und Produktivität von Evidenz (der Information) und Kontrolle (des Untertans), die Möglichkeiten der Steuerung, Disziplinierung und Manipulation durch die rationalen Handlungsmaximen einer modernen, als Maschine funktionierenden Bürokratie wurden nicht nur bei allen bürokratischen Vorhaben Kempelens sichtbar: sie entsprechen auch den Prinzipien der Konstruktion seines „Türken”. Der Staatsmaschinist Kempelen hat ein Idealbild eines Theresianischen Beamten, einen imaginären Doppelgänger geschaffen – höflich, fleißig, planvoll und furchtlos im Spiel – und sich selbst zu seinem Herrscher gemacht. Seine abgründige Ironie bestand darin, dass der Mensch aus dem Leviathan nicht vollends verschwunden ist.
VI
Im Jahr 1783 suchte Kempelen um einen zweijährigen unbezahlten Urlaub an, um den „Türken” in Europa zu zeigen. Auf der Tournee 1783-1784, die ihn durch Deutschland, Frankreich und England führte, begegnete Kempelen einer für ihn neuen, kritischen Öffentlichkeit, in der bereits andere, weniger höfliche Diskursregeln als am Wiener Hof der 70er Jahre galten.
Die Tournee Kempelens wurde von einer Werbekampagne begleitet. Fast zeitgleich mit den ersten Auftritten Kempelens erschienen Windischs Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen. Die Briefe werden noch im selben Jahr ins Französische, 1784 ins Englische und 1785 ins Niederländische übersetzt.
Die wesentliche Funktion der sieben Briefe von Windisch ist propagandistischer Natur. Sie beschreiben zwar detailreich „die Erscheinung einer mechanischen Figur, die mit einem denkenden beseelten Wesen das schwerste aller Spiele spielt“,20 ohne jedoch das Geheimnis zu verraten.
Windisch positionierte den „Türken” im Kontext der unterhaltsamen Mathematik, die im Spätbarock als Form der populären Gelehrsamkeit einen publizistischen Höhepunkt erreichte. Erwähnt werden die Windisch-Briefe erstmals 1784 in Decremps mehrfach aufgelegter und überaus populärer „La Magie blanche dévoilée” (1784-1789). Henri Decremps, Rechtsanwalt und später selbst Zauberkünstler, war Experte für das Aufdecken von Tricks und decouvrierte problemlos die Funktionsweise von Kempelens Schachspieler.
In London stieß Kempelen auf offene Ablehnung. Windischs Briefe waren auf Englisch unter dem anspruchsvollen Titel „Inanimate Reason” erschienen. Noch im selben Jahr veröffentlichte Philip Thicknesse (1719-1792) ein Pamphlet über den automatischen Schachspieler, in dessen Inneren er ein „Kind, zehn, zwölf oder vierzehn Jahre“ vermutete, das sich im Körper der Puppe versteckt hält und die Partie durch die Brust des Türken beobachtet:
„Dass ein Automat dazu gebracht werden kann, seine Hand, seinen Kopf und seine Augen in bestimmter und regelgeleiteter Weise zu bewegen, steht außer Zweifel; aber dass ein Automat dazu gebracht werden kann, seine Schachfiguren wie ein scharfsinniger Spieler als Antwort auf den vorhergegangenen Zug eines Fremden zu ziehen, der gegen ihn spielt, ist völlig unmöglich: Deshalb ist es Betrug, wenn man von einem Automaten spricht, und das bedarf öffentlicher Observation.“21
Erstmals wird Kempelen nun „Betrug“ unterstellt, statt dass wie zu Beginn der Karriere des Automaten von einer charmanten „Täuschung“ gesprochen wird. Was im höfischen Kontext noch als naturwissenschaftliche Unterhaltung akzeptiert war – gleichgültig, wie die Technik nun „wirklich“ funktionierte – erschien in der bürgerlichen Gesellschaft Englands, in der die industrielle Revolution viel weiter gediehen war, als Betrug am Publikum, das adäquate Leistung für sein Geld einforderte. Erstmals wird deutlich, dass die barocke Inszenierung Kempelens auf internationalem Parkett nicht mehr so recht funktionierte. In Berlin brach der Furor der Aufklärung in Gestalt von Friedrich Nicolai (1733-1811) über Kempelen herein. Nicolais Kempelenkritik orientierte sich vor allem an den Fragen der Nützlichkeit bzw. Schädlichkeit für die Sache der Aufklärung:
„Ich bin ein Freund der Wahrheit und ein Feind des Scheins und der Vorspiegelungen. Ich mag nicht, daß man Wunder suche, wo keine Wunder sind. Die optata praemia, welche Herr von Kempelen in Frankreich, England und Deutschland so reichlich eingeärndtet hat, gönne ich ihm von Herzen. Meine Sorge ist nur, ne vulgus fallatur! Ich will nicht, daß die unphilosophische Modesucht sich allenthalben geheime Wirkungen und Wunderkräfte zu denken auch durch Täuschung der Schachmaschine befördert werde. Ich will vielmehr durch dieß abermalige Beyspiel zeigen, daß gemeiniglich, wo wer weiß welche Wunderwerke vorgespiegelt werden, bloß ganz gemeine Täuschung vorhanden zu seyn pflegt.“22
Man merkt, es geht um’s Prinzip. Nicolai besteht auf einer klaren Trennung zwischen „Täuschung und Taschenspielerey“ auf der einen Seite und einem „wirklichen mechanischen Werk“23 auf der anderen. Da er Kempelens „Türken” nicht zu letzterer Gattung zählt, sind die Werke des Erfinders nichtig, auch wenn er diesem das nötige „Talent“ zugesteht, eine derart „subtile Täuschung“ überhaupt hervorzubringen. Fest steht:
„Jeder vernünftige Mensch kann einsehen, es sey unmöglich, daß eine Maschine durch innern Mechanismus Schach spielen, das heißt eine Handlung vornehmen soll, wozu Vernunft und Ueberlegung erfordert wird.“24
Das Lob der „charmanten Täuschung“ in Österreich in den 70er Jahren und die nervöse Reaktion in der deutschen Aufklärung in den 80er Jahren zeigen einen mentalitätenhistorischen Bruch an: Das alte Konzept der Gelehrsamkeit erodierte und wurde mit dem Konzept der kritischen Wissenschaft konfrontiert. Damit wird auch die Figur des wissenschaftlichen Schaustellers vom Typus des Wissenschaftlers abgelöst, der durch Beweise seiner Nützlichkeit und durch soziale Abgrenzung vom Gelehrten und Schausteller begonnen hatte, seinen neuen gesellschaftlichen Status zu festigen und seine Rolle zu definieren. Neue Codes der wissenschaftlichen Rationalität werden in der frühen Industriegesellschaft geschaffen, andere, ältere Diskursformen der „polite culture”, denen noch Kempelen angehörte, in ihrem Status devalorisiert.25
Kempelens barocke Inszenierung des „Türken” war jedoch dem älteren Codierungssystem der Gelehrsamkeit und der polite culture vor einem adeligen Publikum verpflichtet, das es mit den Begriffen noch nicht so genau nahm und das „Täuschung“ als Instrument der Wissensvermittlung und als Lernmodell noch akzeptierte.
Erfolg und Misserfolg seiner Präsentation zeigen deshalb die Ungleichzeitigkeiten der Aufklärung in Europa an. Die „Dame Vernunft“, die „Tochter der Zeit“, die in Voltaires 1768 erschienener Erzählung „Der Mann mit den vierzig Talern” durch Europa reist, war im rückschrittlichen Österreich noch nicht angekommen.26
VII
Kempelen starb am 26. März 1804 in Wien. 1806 ließ Carl von Kempelen, sein Sohn, den „Türken” einige Male „zum Vortheil armer Familien“27 auftreten, etwas später wurde der Schachspieler vom „Kunstmaschinisten“ Johann Nepomuk Mälzel erworben und in seine Automatenshow integriert. Ab 1819 geht Mälzel auf eine ähnliche Tournee wie Kempelen fast 40 Jahre zuvor; der „Türke” spielt in Paris, in englischen Städten und in Amsterdam und ab 1826 an der Ostküste der USA. 1854 wird der „Türke” bei einem Brand zerstört.
Die Zahl der Berichte wird in diesem Zeitraum nicht geringer, im Gegenteil: Wo immer Mälzel mit dem Schachspieler auftrat, erschienen nach wie vor Ankündigungen, Berichte und Versuche, dem Rätsel seiner Funktionsweise auf die Spur zu kommen. Das Urteil ist jedoch milde geworden. Bereits im fünften, 1793 erschienenen Band von Johann Samuel Halles viel gelesener „Fortgesetzter Magie” heißt es versöhnlich:
„[...] ohngeachtet des verborgenen Menschen im Schachspiele, ohngeachtet des Zeisigs im Kopfe des Flötenspielers, bleiben solche und anderer dergleichen Automaten immer ein bewundernswerthes Meisterstück des menschlichen Erfindungsgeistes, und der Mechanismus, welcher darinnen herrscht, macht sie immer zu kostbaren Monumenten des menschlichen Kunstfleißes.“28
Auch der junge Robert Willis, Assistent von Charles Babbage, lässt es in seiner kritischen Schrift „An Attempt to analyse the Automaton Chess Player, of Mr. de Kempelen” aus dem Jahre 1821 nicht an Lob für den Erfinder fehlen. Die Referenz an Kempelen liest sich bereits wie die freundliche Erinnerung an ein Vergangenes, das seinen Stachel verloren hat:
„Bei der Durchführung dieser Analyse hatte der Autor nicht den leisesten Wunsch oder die Absicht, die wahren Verdienste von Herrn von Kempelen herabsetzen oder schmälern zu wollen: Diese Verdienste wurden längst durch die öffentliche Anerkennung gewürdigt; tatsächlich, einer braucht mehr als nur normale Fähigkeiten und Einfallsreichtum, der eine Maschine (gleich durch welche Art und Weise) planen und konstruieren kann, die – mehr als jede andere Maschinen dieser Art – die Freunde der Menschen niemals enttäuscht, indem sie fortwährend jene geistige Täuschung unterstützt, welche der römische Dichter so glückhaft ‚Mentis gratissimus error’ bezeichnet hat.“29
In gewissem Sinn bildet das Urteil von Johann Heinrich von Poppe den Abschluss der Diskussion über den Schachautomaten, zumindest in Deutschland. Poppe gehörte zu den bedeutendsten Mathematikern und Physikern Deutschlands, begründete 1816 in Frankfurt die „Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste“ und lehrte ab 1818 als Professor für Technologie in Tübingen. Sein „Wunder der Mechanik, oder Beschreibung der berühmten Tendlerschen Figuren, der Vaucansonschen, Kempelenschen, Drozschen, Maillardetschen und anderer merkwürdiger Automaten” von 1824 enthält Erinnerungen an die bekanntesten Vergnügungsautomaten des 18. Jahrhunderts, die der Wissenschaftler nicht verachtete oder bekämpfen musste. Sie konnten als „bewunderungswürdige mechanische Kunstwerke“ zu einer Einführung in die Wissenschaft der Mechanik genützt werden:
„Die Mechanik ist jetzt auf eine Höhe gestiegen, welche man früher für unerreichbar gehalten haben würde. Mit Recht bewundern wir so große Fortschritte, besonders im praktischen Theile dieser Wissenschaft, und staunen viele Werke der Bewegungskunst an, welche durch Genie und Fleiß des Menschen zum Vorschein gekommen sind.“30
Kein Zweifel besteht im Fall des Kempelenschen Mechanismus, „daß hier ein verborgener lebendiger Mensch das Spiel regieren und durch Maschinerien auf die spielende Figur hinwirken mußte“.31 Das Kapitel über den Schachspieler beschließt Poppe bereits in der Vergangenheitsform:
„Auf jeden Fall verdiente dieses Kunstwerk die hohe Bewunderung, welche ihm zu Theil wurde. Welche Genauigkeit zur Ausführung des Werks und welche Aufmerksamkeit und Uebung zu dem Spiel selbst gehörte, wird Jeder leicht einsehen.“32
Die Erregung über den „Fall Kempelen“ hatte sich gelegt, technische Rationalität, wissenschaftliche Forschung und ihre neuen Sprachformen hatten sich so weit institutionalisiert, dass sie nicht mehr unter Legitimationszwang standen. Maschinenwebstuhl, Dampfeisenbahn und der moderne, nach dem Vorbild der Maschine funktionierende Verwaltungsstaat beherrschten den Alltag der Menschen in Europa, 1837 erstellte Charles Babbage (1791-1871) erste Entwürfe zu einer „Analytischen Maschine“, die bereits die Architektur der Turingschen Universalmaschine, des Computers, präludierte.
Parallel zum Prozess der Statuserhöhung des Wissenschaftlers, in dessen Sog Kempelens „Türke” geraten war, hatte sich in der bürgerlichen Gesellschaft durch die Trennung von Arbeits- und Freizeit eine neue institutionalisierte Freizeitkultur entwickelt, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer rasch expandierenden Industrie wurde. Das Auseinandertreten der Institutionen Wissenschaft und Unterhaltung mit je eigenen Gesetzen der Produktion, Distribution und Konsumtion und der Niedergang der „polite culture“ veränderte auch die Rolle und Funktion der wissenschaftlichen Schausteller und der Automatenbauer. Sie mussten sich entscheiden, für Zwischenstellungen, wie sie Kempelens „Türke” einnahm, blieb kein Raum: zu langsam und seriös für die neue Welt der Unterhaltung, zu verspielt, um als wissenschaftlich zu gelten, kurz: zu schön, um jemals wahr gewesen zu sein.
VIII
Ein Postskript: Die Echos der Kempelenschen Automaten verstummen auch heute nicht ganz: „The Turk“ nennt etwa Google seine weltweite Plattform für Arbeitsvermittlung, neue Interpretationen der Geschichte erscheinen, Nachbauten des Automaten werden fertiggestellt und mit Erfolg präsentiert.
250 Jahre nach der ersten Vorführung des Schachspielers ist der Mensch allerdings weitgehend aus den Maschinen verschwunden. Die Schachprogramme sind längst unschlagbar geworden. Die Automaten haben andere Aufgaben übernommen. Sie komponieren, malen, tanzen oder trösten uns. Wir akzeptieren die neuen Möglichkeiten der Technik.
In Japans angewandter Robotronik-Forschung werden Pflegeroboter konzipiert, die den Alltag alter und dementer Menschen erleichtern und bei Bedarf kuscheln, in San Francisco bringen bereits die ersten fahrerlosen Taxis Kunden autonom an ihren Bestimmungsort. Die spanische Künstlerin Alicia Framis heiratete am 11. Oktober 2024 in einer medial spektakulären Aktion die Künstliche Intelligenz „AILex”, die bzw. der in Gestalt eines Hologramms auftritt und mit ihr den Alltag teilt. Es ist die erste Lebenspartnerschaft dieser Natur. Hologramme wie „AILex”, sollen uns, so die Künstlerin, in Zukunft „vor Einsamkeit bewahren“33. Die hybride Partnerschaft zwischen Künstlicher Intelligenz und Mensch wird körperlichen Kontakt nicht ausklammern, sie führt, folgt man der Künstlerin, zu neuen Formen technosexuellen Verhaltens. Mittels technischer Hilfsmittel mit Biofeedbackfunktionen und sensibler Robotronik kann dabei nebenbei heute auch der menschliche Orgasmus optimiert werden.
Die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz dominieren die Spielkulturen der Gegenwart und reichen bis in die hintersten Winkel der privaten Existenz. Doch bei den Techno-Inszenierungen der Gegenwart, die wir wie das Publikum Kempelens staunend verfolgen, geht es meines Erachtens um etwas anderes: Waren vor 250 Jahren die Androiden und Spielautomaten die Begleitmusik der Mechanisierung der Güterproduktion, der Industrialisierung, so sind wir heute mit der Automatisierung des Dienstleistungssektors (des so genannten tertiären Sektors neben der Lebensmittel- und Sachgüterproduktion) konfrontiert. Automatisiert werden Bereiche der Kommunikation, des Handels, der Verwaltung und Beratung, durch Maschinen ersetzt werden Berufe im Gesundheitswesen und in der Erziehung, im Gastgewerbe ebenso wie im Transportwesen. „Open AI” gilt 2024 als wichtigstes Startup der Welt und ist eines der am höchsten bewerteten Unternehmen der USA – und zwar nicht wegen der Spiele und amüsanten Unterhaltungen, die uns die Automaten als Ersatz für menschliche Kommunikation und Sex anbieten.
Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, ob die These, die Günther Anders zur Mitte des 20. Jahrhunderts in „Die Antiquiertheit des Menschen” formuliert hat, dass wir im Grunde „Automatenhirten“ seien, die die Spiele der Technik nur noch beaufsichtigen, aber nicht mehr selber mitspielen, in dieser Form noch stimmt. Eher erscheint mir, dass wir uns der Technik anpassen, also dass wir es sind, die in unserem Verhalten die Automaten simulieren und nicht sie uns. Sie lassen uns schon mitspielen, wenn und solange wir uns richtig benehmen.
Das Ticken hören wir dann nicht mehr, weder am Schachbrett noch in der Liebe.
Ernst Strouhal unterrichtet an der Universität für angewandte Kunst Wien (Abteilung Kulturwissenschaften). 2010 Österreichischer Staatspreis für Kulturpublizistik. Zuletzt in Buchform erschienen: „Über kurz oder lang. Essays und Reportagen” (2024).
Der vorstehende Artikel ist Ergebnis einer langen Zusammenarbeit mit Brigitte Felderer im Rahmen eines Forschungsschwerpunkts gemeinsam mit Jakob Scheid an der Universität für angewandte Kunst Wien. Über viele Jahre hinweg wurden in gemeinsamer Arbeit Quellen zu Kempelens Automaten versammelt und Texte zu beiden Maschinen publiziert. Der Artikel ist die fortgeschriebene und aktualisierte Fassung eines Vortrages beim Haydn-Symposion an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
1 Henrike Leonhardt, Der Taktmesser. Johann Nepomuk Mälzel, Hamburg 1990, S. 94.
2 Ken Whylds penible Bibliographie Fake Automata in Chess, Caistor 1994, weist mehrere hundert Einträge auf, das Wiener Kempelen Archiv an der Universität für angewandte Kunst Wien, das den Quellen und der Rezeptionsgeschichte Kempelens von 1734 bis 2000 gewidmet ist, umfasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, rund 1300 Dokumente, seitdem dürfte sich die Zahl der Beiträge wohl verdoppelt haben.
3 Alan M. Turing widmet eine der bei ihm seltenen historischen Reminiszenzen dem Schachspieler (vgl. Intelligence Service. in: Schriften. Hrsg. v. B. Dotzler und F. Kittler, Berlin 1987), und Walter Benjamin reserviert für ihn in der ersten These in Über den Begriff der Geschichte einen prominenten Platz (Gesammelte Schriften, Bd. 2.1, Frankfurt a.M. 1991, S. 691-707). Benjamin konnte auf eine lange Tradition der Bearbeitung des Kempelenstoffes zurückgreifen: In der deutschen Romantik haben die Automaten Kempelens Erwähnung vor allem bei Jean Paul und E.T.A. Homann gefunden. Das Unheimliche des anthropomorphen Automaten bildet den Ausgangspunkt vieler Bearbeitungen des Kempelen-Stoffes in den Gothic Novels im späten 19. und 20. Jahrhunderts und im Horrorfilm, etwa bei Sheila E. Braine (The Turkish Automaton, London 1899), die eine Passage in den Erinnerungen des amerikanischen Zauberkünstlers Robert Houdin (vgl. auch Edgar Allen Poe, Von Kempelens Erfindung, in: Der Rabe. Erzählungen, englisch 1849) aufnimmt, in Henry Dupuy-Mazuels mehrfach ver lmtem Bestseller Le joueur d’échecs (Paris 1926), im Stummfilm White Tiger (1923) von Tod Browning, dem Regisseur von Freaks (1932), und in Juan Luis Buñuels groteskem Mälzels Schachspieler (1965). Das Motiv des Katastrophischen der Begegnung reicht bis zu Ridley Scotts SF-Klassiker Blade Runner (1982), in dem sich der nietzscheanische Replikant Roy Batty durch einen genialen Schachzug Zutritt zu seinem Schöpfer Dr. Tyrell verschafft und diesem das Genick bricht. Zur Renaissance des Kempelenmotivs in der unmittelbaren Gegenwart vgl. z.B. die historischen Romane von Waldemar Lysiak (Schach dem König, Hamburg 1995) u. Vladimir Langin (Legenda o sachmaton avtomate, St. Petersburg 1993), das Opernlibretto Lutz Hübners (Der Maschinist, Köln 1999) das Drehbuch und der Roman von Richard Löhr (beide Der Schachautomat, uv. Berlin 2000, München 2005) und Der Türke von Tom Standage (Frankfurt, New York 2002). Zur Rezeptionsgeschichte im 19. u. 20. Jahrhundert vgl. Ernst Strouhal, Technische Utopien (Wien 1991), Menschen in Maschinen (Der Standard, Wien 1999), Eine exible Geschichte. Kempelens Türke (KARL 2002).
4 Felderer/Strouhal 2007, vgl. auch Felderer/Strouhal 2004, Felderer/Strouhal 1989.
5 Siehe etwa neben Jean Paul und E.T.A. Homann die wenig bekannte Schrift von Johann Phillipp Ostertag Etwas über den Kempelischen Schachspieler (Frankfurt/M 1783).
6 zB. Louis Dutens, Lettres sur un automate (Paris 1772), S.156 (3. Brief).
7 S. Schwarz, Vor hundert Jahren. Elise von Reckes Reisen (Stuttgart 1884), S.60.
8 Vgl. Oliver Hochadel, Öffentliche Wissenschaft (Göttingen 2003); Otto Krätz, Historische chemische und phaysikalische Versuche (Köln 1979), S.35.
9 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Glücksspielpatent Leopold I. vom 12.10.1696.
10 Edgar Allen Poe, Mälzels Schachspieler, in: Der Rabe (Zürich 1994), S.365.
11 Siehe ausführlich Alex Sutter, Göttliche Maschinen (Frankfurt/M 1988).
12 Jules Oray de La Mettrie, Der Mensch - eine Maschine (Leipzig 1984), S.113.
13 Paul Henry Thiry d’Holbach, System der Natur (Berlin 1960 = 1770), S.191f.
14 Vgl. ausf. E. Strouhal, Uhrwerk und Schachspiel (in: Felderer, Wunschmaschine, 1996).
15 Gustavus Selenus, Das Schach= oder König=Spiel (Leipzig 1616).
16 Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit (München 1992), S.130.
17 Michel Foucault, Überwachen und Strafen (Frankfurt/M 1994), S.36.
18 Kempelen, Grundriß zu einer Systematischen Landeseinrichtung des Temesvarer Banats (Hofkammerarchiv Wien, Hs. 996, fol. 2v-95v; 20. Februar 1769), § 36.
19 Friedrich Walter, Männer um Maria Theresia (Wien 1951), S.55.
20 Karl G. Windisch, Briefe über den Schachspieler d. Herrn v. Kempelen (Basel 1783), S.7.
21 P. Thicknesse, The Speaking figure and the Automaton Chessplayer (London 1784), S.4f.
22 F. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland u.d. Schweiz (Berlin 1785), S.435.
23 F. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland u.d. Schweiz (Berlin 1785), S.423.
24 F. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland u.d. Schweiz (Berlin 1785), S.420.
25 O. Hochadel, Öffentliche Wissenschaft (2003), M. Vovelle, Der Mensch der Aufklärung (1996), Bödeker, Reill, Schlumbohm, Wissenschaft als kulturelle Praxis (1999).
26 Voltaire, Der Mann mit den vierzig Talern, in: Sämtliche Romane (1768 = 1977), S.588f.
27 Anonym, Ankündigung des C. v. Kempelen (Wiener Zeitung, 12. Februar 1806).
28 Johann Samuel Halle, Fortgesetzte Magie oder die Zauberkräfte (Wien 1793), S.338.
29 Robert Willis, An attempt to analyze the automaton chess player (London 1821), S.30.
30 Johann Heinrich Moritz v. Poppe, Wunder der Mechanik (Tübingen 1824), S.01.
31 Johann Heinrich Moritz v. Poppe, Wunder der Mechanik (Tübingen 1824), S.14.
32 Johann Heinrich Moritz v. Poppe, Wunder der Mechanik (Tübingen 1824), S.19.
33 Silke Weber, Kann man ein Hologramm heiraten? (FAZ 30.07.2024). Auch Youtube.
- Quelle:
- Die Puppe
- Sirene Operntheater
- Ein Operoid - 1. bis 7. November 2024
- S. 41-60
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe