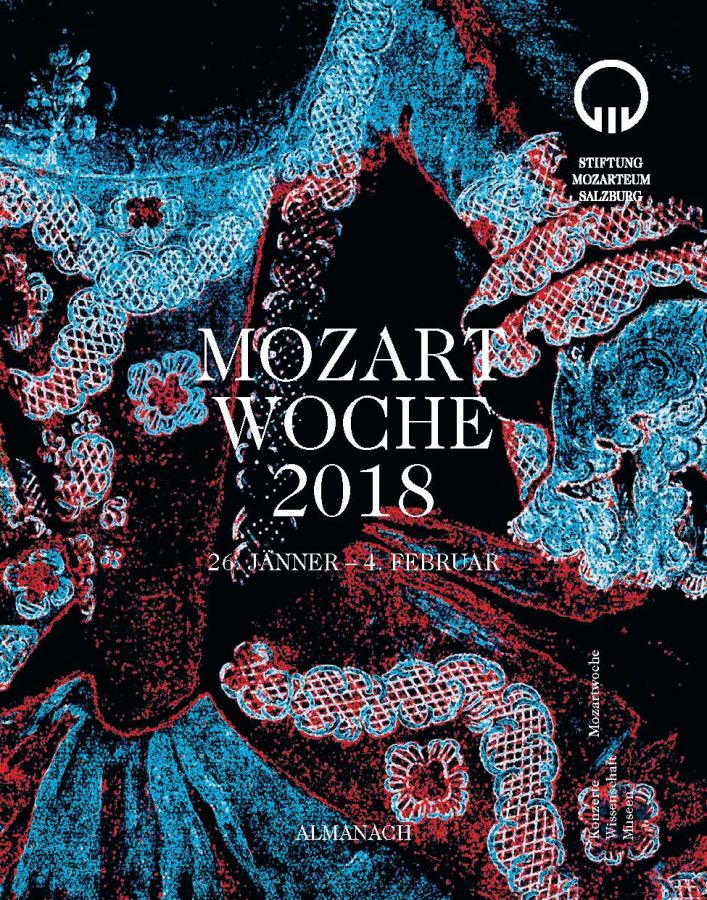- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2018
- S. 22-27
Mozart und Bach
Text: Ulrich Leisinger
In: Almanach, Mozartwoche 2018, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 22-27 [Programmheft]
Unter den gut 25.000 Literaturangaben, die die Bibliotheca Mozartiana als Mozart-Bibliographie bis zum heutigen Datum erfasst hat, weisen 220 die Namen Bach und Mozart gemeinsam im Titel auf. Selbst wenn man diese beeindruckende Liste um Einträge wie „Carl Maria von Weber – im Schatten von Bach, Mozart und Beethoven“ und um Aufsätze über Mozarts Verhältnis zu den Bach-Söhnen bereinigt, bleibt eine beachtliche Fülle an Beiträgen aus fast 150 Jahren Musikgeschichtsschreibung stehen. Dabei sind in dieser Zahl die vielen, mehr oder weniger ausführlichen und erhellenden Auseinandersetzungen mit dem Thema in Mozart- oder Bach-Biographien oder Büchern zur allgemeinen Musikgeschichte gar nicht eingerechnet. Eine entsprechende Auswertung für Georg Friedrich Händel bringt nur einen Bruchteil an Titeln – etwa 50 – zutage, die sich überwiegend mit den gut dokumentierten Bearbeitungen der großen Oratorien „Acis und Galatea“ KV 566, „Der Messias“ KV 572, „Das Alexander-Fest“ KV 591 und die „Cäcilien Ode“ KV 592 für Aufführungen unter Mozarts Leitung in den letzten Wiener Jahren beschäftigen. Mozart hat zudem eigenhändig Werke von Händel abgeschrieben (zum Beispiel die Fuge d-Moll aus der Suite HWV 428), für Streichquartett arrangiert (Fuge F-Dur aus der Suite HWV 427) oder exzerpiert (etwa einige Takte aus Präludium und Chaconne G-Dur HWV 442 auf dem Skizzenblatt 1782b oder aus „Joshua“ auf dem Skizzenblatt 1788a). Zudem haben schon die Zeitgenossen auf bemerkenswerte kompositorische Momente in Mozarts Schaffen hingewiesen, die ohne Händel nicht zu verstehen seien. Hierzu gehören in erster Linie die Spuren des „Funeral Anthem for Queen Caroline“ HWV 264 im Eingangssatz des Requiems KV 626, aber auch die Imitationen von Händels Stil in der c-Moll-Messe KV 427 (lange Zeit besser bekannt in ihrer Bearbeitung als „Davide penitente“ KV 469), etwa im „Qui tollis“, oder auch in der Arie „Ah fuggi il traditor“ aus „Don Giovanni“ KV 527. Diese konkreten Vorbilder lassen es verständlich erscheinen, warum es schon 1798 in der einflussreichen „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ heißen konnte: „Unter den ältern Komponisten schäzte er ganz besonders verschiedene ältere Italiener, die man leider jetzt vergessen hat, am allerhöchsten aber Händeln. Die vorzüglichsten Werke dieses in einigen Fächern noch nie übertroffenen Meisters, hatte er so inne, als wenn er lebenslang Direktor der Londner Akademie zur Aufrechterhaltung der alten Musik gewesen wäre.“
Der Fülle an musikwissenschaftlicher Literatur zum Thema „Bach und Mozart“ stehen letztlich erstaunlich wenig belastbare historische Fakten gegenüber: eine Handvoll Briefstellen, einzelne musikalische Quellen aus dem Umfeld Mozarts (darunter immerhin einige Bearbeitungen Bachscher Fugen von Mozarts eigener Hand) und schließlich einige wenige Anekdoten, die zwar das Bild von Mozarts Verhältnis zu Bach geprägt haben, deren Wahrheitsgehalt aber meist nur schwer zu prüfen ist. Am bekanntesten ist hier die Geschichte, wie Mozart sich auf seiner Reise nach Berlin im Jahre 1789 in Leipzig aufhielt und dort eine Aufführung der achtstimmigen Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“ BWV 225 gehört und begeistert ausgerufen habe: „Das ist doch einmal Etwas, woraus sich was lernen lässt!“ Mozart habe sich vom Thomaskantor Johann Friedrich Doles die Stimmen zeigen lassen (eine Partitur der fest zum Aufführungsrepertoire des Thomanerchores gehörenden Motetten gab es nicht), gründlich studiert und eine Abschrift des Werkes erbeten. Hier endet die Anekdote, und die Quellenüberlieferung setzt ein: In Archiv und Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien werden Abschriften zweier Bach zugeschriebener Motetten – „Singet dem Herrn ein neues Lied“ BWV 225 und „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ BWV Anh. III 160 aufbewahrt, die im späten 18. Jahrhundert in Leipzig entstanden sind und von denen die erstgenannte den Vermerk „NB müßte ein ganzes orchestre dazu gesezt werden“ von der Hand Wolfgang Amadé Mozarts aufweist und damit die Anekdote in ihrem Kern bestätigt. Ob Mozart diesen Vorsatz ausgeführt und ob das Werk tatsächlich unter seiner Leitung jemals in Wien erklungen ist, bleibt jedoch unklar.
Schon bei der Frage, wann Mozart erstmals mit Werken Johann Sebastian Bachs in Berührung gekommen ist, lassen uns die Quellen im Stich. In Salzburg spielte Bach im Musikleben jedenfalls keine Rolle: Eine einzige Quelle, das Orgelbüchlein des Mattseer Stifts organisten Johann Anton Graf aus dem Jahre 1738, das die Schlussfuge aus Bachs Toccata e-Moll BWV 914 enthält, kann heute als Beleg für eine Salzburger Bach-Tradition vor 1780 dienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mozart den Band, der im Kontext des Bach-Stücks mit Werken von Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar Kerll und Johann Philipp Krieger auch Stücke aus dem 17. Jahrhundert enthält, jemals in seinem Leben gesehen oder gar studiert hätte, ist als sehr gering einzustufen. Immerhin, einige der theoretischen Schriften, die Leopold Mozart bei der Abfassung seiner 1756 gedruckten „Violinschule“ herangezogen hatte und wohl zum Teil auch selbst besaß, enthalten Auszüge aus Bachschen Kompositionen. Auf diese Weise hat der junge Mozart vielleicht sogar den Nekrolog auf Johann Sebastian Bach kennengelernt, den sein Sohn Carl Philipp Emanuel und der Bach-Schüler Johann Friedrich Agricola 1754 für Lorenz Christoph Mizlers „Musikalische Bibliothek“, das ,Mitgliederjournal‘ der „Correspondierenden Societät der musicalischen Wissenschaften“, verfertigt hatten. Dieser Vereinigung von gelehrten Musikern gehörten nicht nur Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel an; auch Leopold Mozart war 1755 zur Aufnahme vorgesehen, doch verlieren sich um diese Zeit die Spuren der Aktivitäten der noch mindestens bis 1761 bestehen den Societät im Dunkeln.
Auch Leopold Mozarts Brief aus London vom 28. Mai 1764 an den Salzburger Freund und Vermieter Lorenz Hagenauer erweist sich als nicht sonderlich tragfähig. Dort heißt es zwar im Zusammenhang mit einer Einladung an den Hof, bei der Wolfgang für den englischen König und die Königin spielte: „Der König hat ihm nicht nur Stücke vom Wagenseil, sondern vom Bach, Abel, und Händel vorgelegt, alles hat er prima vista weggespielt“, doch dürfen wir uns von der Erwähnung Händels nicht irreführen lassen: Die Stellung des Namens Bach zwischen Georg Christoph Wagenseil und Carl Friedrich Abel und der Verzicht auf einen Vornamen lassen vermuten, dass Leopold hier nicht den Leipziger Meister des Kontrapunkts, sondern den ,Londoner Bach‘, seinen im galanten Stil komponierenden Sohn Johann Christian Bach meinte, der in mehreren vorangegangenen Schreiben als Musiker und Freund der Familie ausführlich geschildert worden war.
Auch die Berichte von den Reisen nach Italien zwischen 1769 und 1773, nach Mannheim und Paris 1777/79 und München 1780/81 geben keine Spuren preis, wann und wie Mozart mit Werken Johann Sebastian Bachs bekannt geworden ist und welche Wirkung sie auf ihn und sein kompositorisches Schaffen ausgeübt haben. Nur ein einziges Mal, am Anfang der Wiener Zeit, sprudeln die Quellen, um sehr rasch wieder zu versiegen. Obwohl Mozart die Kaiserstadt 1762 als Sechsjähriger zum ersten Male gesehen und bei seinen ausgedehnten Aufenthalten in den Jahren 1768 und 1773 mit all ihren Facetten (bis hin zu Intrigen) als Musikzentrum von europäischem Rang kennengelernt hatte, war er von den Möglichkeiten, die sich ihm im Jahre 1781 boten und die im Essay von Ulrich Konrad in diesem Almanach näher beleuchtet werden, schier überwältigt. Zu den ganz neuen Erfahrungen gehörte die Begegnung mit Gottfried van Swieten, dem Präfekten der Hofbibliothek, der selbst komponierte (auch wenn Haydn ihn für „ebenso steif wie seine Sinfonien“ hielt) und der sich – wie man heute sagen möchte – als das Zentrum der ,Alten-Musik-Bewegung‘ in Wien verstand. Während seiner Jahre als Kaiserlicher Gesandter in Berlin zwischen 1770 und 1777 hatte van Swieten mehrere Bach-Schüler, darunter Wilhelm Friedemann Bach, Johann Friedrich Agricola und vor allem Johann Philipp Kirnberger persönlich kennengelernt und aus der preußischen Hauptstadt eine Reihe von Kopien Bachscher Werke nach Wien mitgebracht. Über Jahrzehnte veranstaltete er wöchentliche Matineen in seiner Wohnung (noch Beethoven weiß hierüber zu berichten), über die Wolfgang Amadé Mozart seinem Vater am 10. April 1782 mitteilte: „ich gehe alle Sonntage um 12 uhr zum Baron von Suiten – und da wird nichts gespiellt als Händl und Bach.“
Welchen Eindruck diese Matineen auf ihn machten, lässt sich am Nachsatz unschwer ersehen: „ich mach mir eben eine Collection von den Bachischen fugen. – sowohl sebastian als Emanuel und friedeman Bach. – Dann auch von den händlischen.“ Und schon 10 Tage später übersandte er seiner Schwester Maria Anna Präludium und Fuge C-Dur KV 394 mit den Worten: „die ursache daß diese fuge auf die Welt gekommen ist wirklich Meine liebe konstanze. – Baron van suiten zu dem ich alle Sonntage gehe, hat mir alle Werke des händls und Sebastian Bach (nachdem ich sie ihm durchgespiellt) nach hause gegeben. als die konstanze die fugen hörte, ward sie ganz verliebt darein; – sie will nichts als fugen hören, besonders aber (in diesem fach) nichts als Händl und Bach; – weil sie mich nun öfters aus dem kopfe fugen spiellen gehört hat, so fragte sie mich ob ich noch keine aufgeschrieben hätte? – und als ich ihr Nein sagte. – so zankte sie mich recht sehr daß ich eben das künstlichste und schönste in der Musick nicht schreiben wollte; und gab mit bitten nicht nach, bis ich ihr eine fuge auf sezte, und so ward sie.“
Wer Mozarts Briefe näher kennt, weiß, dass bei der Bewertung von Aussagen, die mit so viel Euphorie vorgetragen werden, Vorsicht angebracht ist. Ziel dieses Schreibens war es weniger, Händel und Bach als vielmehr seine Braut Constanze Weber zu preisen, der Vater und Schwester – ohne sie persönlich zu kennen – skeptisch-ablehnend gegenüberstanden. Die gleiche Strategie, die der Vater sicherlich durchschaute, hat Wolfgang auch mit der bewussten Gleichsetzung seiner Braut mit der tugendhaften Protagonistin seiner Oper „Die Entführung aus dem Serail“ in seinen Briefen nach Salzburg verfolgt. Dass Mozarts Pläne, eine ganze Sammlung Bachscher Fugen, in der bezeichnenderweise Werke der älteren Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel gleichberechtigt neben denen des Vaters standen, anzulegen, nicht im Sande verliefen, sondern wenigstens teilweise realisiert wurden, geht immerhin noch aus der Bitte vom 6. Dezember 1783 an den Vater, ihm „Seb: Bachs fugen“, die er offenbar bei seinem Besuch in Salzburg im Gepäck gehabt hatte, nach Wien nachzusenden. In diesen Kontext gehört vielleicht auch die Einrichtung von Fugen aus dem 2. Teil des „Wohltemperierten Klaviers“ für Streichquartett KV 405. Mozart hat die fünf ersten dreistimmigen Fugen dieser Sammlung zum Teil in bequemer zu spielende Tonarten, aber ohne sonstige kompositorische Eingriffe für Violine, Viola und Violoncello übertragen. Dass die Einrichtung für die Matineen bei van Swieten bestimmt waren, liegt auf der Hand, doch fehlen weitere Belege: Weder gibt es zeitgenössische Berichte über Aufführungen noch Wiener Abschriften der Kompositionen. Bis zum heutigen Zeitpunkt lässt sich auch nicht mit Gewissheit sagen, ob ähnliche Bearbeitungen von vierstimmigen Fugen von Johann Sebastian und Wilhelm Friedemann Bach, denen zum Teil neukomponierte Einleitungen vorangestellt sind und die Alfred Einstein 1937 als KV 404a für Mozart reklamiert hat, auch tatsächlich von diesem bearbeitet worden sind. Wir wissen heute vielmehr, dass es eine lange zurückreichende Wiener Tradition in der Bearbeitung von Klavierfugen für Streicher gegeben hat, wofür sich auch Joseph II. begeistern konnte, und dass Mozart zwar die berühmteste, aber keineswegs einzige Figur in der Wiener Bach-Rezeption des 18. Jahrhunderts war. Und den sechs Fugen KV 404a ließe sich noch mindestens eine weitere Fugenbearbeitung, ein Arrangement der Fuge C-Dur BWV 870, aus den Sammlungen der Gesellschaft der Musikfreunde zur Seite stellen, die den Namen ihres Bearbeiters gleichfalls nicht preisgibt.
Mit diesen Quellen haben wir den Bereich des gesicherten Wissens bereits verlassen, da ein Bezug zu Mozart nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. Alles Weitere ist Spekulation: Genügt die Tatsache, dass Vögele Itzig (eine Schülerin Wilhelm Friedemann Bachs), die nach ihrer Eheschließung als Fanny von Arnstein nach Wien gekommen war und in deren Haus Am Graben Mozart ab August 1782 für elf Monate Quartier bezogen hatte, Johann Sebastian Bachs Orgeltrios BWV 525–530 in einem Arrangement für zwei Claviere besaß, um zu behaupten, dass Mozarts Fuge c-Moll für zwei Klaviere KV 426 eine unmittelbare Folge seines Bach-Erlebnisses ist? Dürfen wir aus dem Wissen, dass Gottfried van Swieten eine Kopie der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach aus Berlin mitgebracht und Mozart erlaubt hatte, „alle Werke des händls und Sebastian Bach (nachdem ich sie ihm durchgespiellt) nach hause“ mitzunehmen, folgern, dass die monumentale, aber unvollendete c-Moll-Messe KV 427, deren Komposition im Wesentlichen in das Jahr 1782 fällt, ein Zeugnis der Bach-Rezeption ist? Und genügt der Hinweis von Maximilian Stadler, der Mozart noch persönlich kennengelernt hat, dass Bachs Bearbeitung des Chorals „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ in Johann Philipp Kirnbergers „Kunst des reinen Satzes in der Musik“ (Berlin 1771/79) zu finden ist, um daraus zu schließen, dass der Gesang der geharnischten Männer in der „Zauberflöte“ ohne das Vorbild Bach gänzlich undenkbar ist? Und selbst wo es Quellen aus erster Hand gegeben hat, sind unserem Wissen enge Grenzen gesetzt: Was hat es mit jener heute verschollenen Abschrift des Zweiten Teils der „Clavier-Übung“ von Johann Sebastian Bach auf sich, die sich nachweislich im Nachlass Wolfgang Amadé Mozarts befand? Hat Mozart das „Italienische Konzert“ BWV 971 und die „Französische Ouvertüre“ BWV 831 jemals gespielt? Und was für einen Nachhall haben diese Werke in seinem Schaffen hinterlassen?
Dass Mozart am Anfang seiner Wiener Jahre den Werken Johann Sebastian Bachs begegnet ist und sich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt hat, ist unstrittig. Die Einordnung dieses Bach-Erlebnisses in das Gesamtbild von Mozart als Mensch und Künstler gelingt aber nicht ohne ein großes Maß an Phantasie und Spekulation. Dies ist nicht grundlegend zu beanstanden, solange die Grenzen zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit zu erkennen bleiben, verrät aber mindestens ebenso viel über unser eigenes Bild der Musikgeschichte wie über das tatsächliche Verhältnis von Mozart zu Bach. Definitive Antworten wird es hier nicht für alle Fragestellungen geben und so müssen wir uns auch künftig keine Sorgen um Zuwachs an anregender Literatur zum Thema „Bach und Mozart“ für die Bibliotheca Mozartiana machen.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2018
- S. 22-27
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe