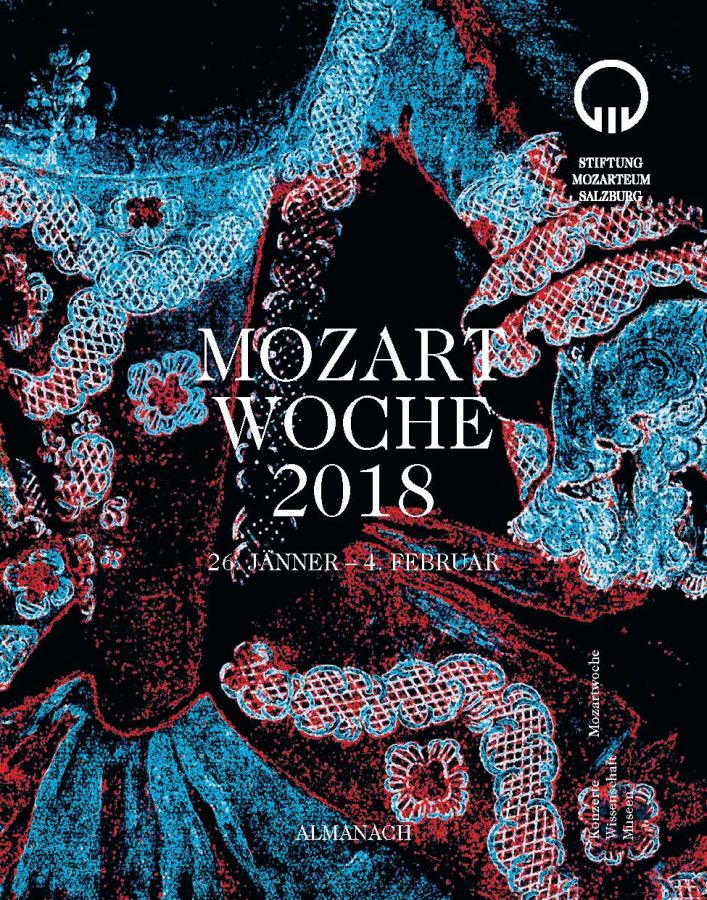- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2018
- S. 48-55
Zwischen ‚türkischer‘ Raserei und aufgeklärtem Pardon
Kulturkonflikt in Mozarts Orient-Opern
Text: Thomas Betzwieser
In: Almanach, Mozartwoche 2018, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 48-55 [Programmheft]
Die sogenannten „Türkenopern“ des 18. Jahrhunderts, insbesondere diejenigen Wiener Provenienz, zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus, dass ihnen ein Kulturkontrast, in einigen Fällen gar ein Kulturkonflikt, innewohnt. Dieser konnte gleichsam subkutan unter dem äußeren Orient-Dekor verlaufen, oder aber ‚sprachlos‘ ausgetragen werden wie in den zahlreichen Ballett-Pantomimen, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts en vogue waren. In diesen ‚türkischen‘ Tanzstücken entwickelte sich ein spezifisches musikalisches Idiom für das Exotische, das wir mit dem Begriff „alla turca“ fassen. Nicht zuletzt mit dem Schlagwerk der ,türkischen Musik‘ hatte das Orientalische – für das die Person des Türken exemplarisch stand – seine charakteristische klangliche Zeichnung erfahren. Den Komponisten oblag es schließlich – ob in Ballett oder Oper – zu entscheiden, welche Figuren mit diesen Türkismen ausgestattet wurden. Sie folgten dabei einer ungeschriebenen Konvention: Weibliche Personen wurden so gut wie nie exotisiert, dies blieb dem männlichen Figurenpersonal vorbehalten. Und hier waren es nicht die ranghöheren Figuren, die mit ,türkischer Musik‘ ausgestattet wurden, sondern mehrheitlich niedere ‚Chargen‘.
Welche dramaturgische Bedeutung diesen Figuren zukam, war im Libretto präfiguriert. Meist kamen diese dramatis personæ nicht über den Status einer exotischen Staffage hinaus. ‚Konfliktuös‘ wurde es erst, wenn zwei Momente ins Spiel kamen: entweder das Militärische oder die Religion. Während das ‚Barbarische‘ des osmanischen Militärs seit den Türkenkriegen des 17. Jahrhunderts auch auf dem Theater zu einem Topos geronnen war – und das Konfliktpotential gleichsam mit sich führte –, verhielt es sich mit dem Thema Religion anders. Obwohl die Darstellung von Religion im Wiener Theater eigentlich tabu war – zumindest solange sie die Würdenträger der katholischen Staatsreligion tangierte –, operierten die Librettisten der Orient-Opern mehr und mehr mit diesem heiklen Thema. Ähnlich wie das Militärische vermochte also der Islam ein genuines Moment für einen möglichen Kulturkonflikt abzugeben.
Ein Musterbeispiel ist die Figur des Kalender in Christoph Willibald Glucks „La Rencontre imprévue“ (1764). Auch hier konzentrierte sich das Exotische ganz auf eine Nebenfigur, der ein Kauderwelsch-Türkisch in den Mund gelegt wird, mit dem die religiösen Riten lächerlich gemacht werden. Allerdings taugte die Figur kaum für einen Religionskonflikt, denn der Kalender, arabisch Qalandar, wurde selbst im Islam argwöhnisch beäugt, da ihm nur ein Minimum an religiösen Pflichten auferlegt war. Zudem ist die Figur in „La Rencontre imprévue“ rein episodischer Natur, zur Handlungsentwicklung trägt sie nichts bei. Und da es keine europäischen Personen in dieser Oper gibt, fehlt dem Stück die Kontrastfolie. Gleichwohl war Glucks Oper in vieler Hinsicht stilbildend, und Mozart kannte die „Pilgrime von Mekka“ sehr gut, schließlich schrieb er über die Kalender-Arie „Unser dummer Pöbel meint“ zehn Klaviervariationen (KV 455).
Mozarts erste Beschäftigung mit dem Genre Orient-Oper fiel just in diese Zeit, Ende der 1770er-Jahre, als er seine „Zaide (Das Serail)“ komponierte. Da wir – in Absenz des Librettos – nicht wissen, wie sich die Handlung dieses Singspiels genau gestaltete, kann über den Ausgang der Intrige nur spekuliert werden. Eines ist den musikalischen Nummern indes ablesbar: Türkisches Kolorit gibt es dort nicht. Auch hier wurde die ranghöchste Person, das ist der Sultan Soliman, nicht exotisch gezeichnet. Dennoch wohnt dem Singspiel ein nicht unerheblicher ‚Kulturkonflikt‘ inne, dessen Schärfe in dem Melodram des Sultans zu Beginn des II. Aktes zum Ausdruck kommt. Es ist dies eine der wenigen Stellen in Mozarts Opernfragment, welche auch den Kern der Handlung transparent macht: Die Favoritin des Sultans wollte mit ihrem (europäischen) Geliebten dem Serail entfliehen, die Flucht scheitert aber und die „Verräter“ müssen sich vor Soliman verantworten:
„SOLIMAN.
Zaide entflohen! – Kann ich den entsetzlichen Schimpf überleben? – Von einem Christenhunde, von einem Sklaven lässt sie sich verführen! – Die Schlange, die sich mit so vieler Sprödigkeit gegen die heftige Liebe eines Sultans geweigert hat. – Ha! – Warum habe ich sie nicht verachtet, diese undankbare Sprödigkeit, warum musste mir ihre gleisnerische Sittsamkeit mein vergiftetes Herz nur immer heftiger entflammen? – Warum gestattete ich der Heichlerin voll Vertrauen auf ihre unbezwingliche Tugend jede im Serail gewöhnliche Freiheit? – O Verräterei!
[…] O Mahomet, lass es wahr sein! Beim ersten Anblick will ich die verräterische Brut in Stücke zerhauen lassen. Blind bei den zauberischen Blicken der treulosen Sklavenbuhlerin will ich dieses entehrte Herz in Stein verwandeln und mit unaufhaltsamer Wut die grenzenlose Beleidigung rächen.“ (II. Akt, 1. Auftritt)
Von einem aufgeklärten, gleichsam liberalen Türken, wie er uns kurz darauf in der Person des Bassa Selim in der „Entführung aus dem Serail“ gegenübertritt, ist dieser Soliman meilenweit entfernt. Der Sultan in „Zaide“ repräsentiert vielmehr ganz das traditionelle, negativ besetzte Türkenbild: kriegerisch, despotisch, aufbrausend. Vergeltung ist das Leitmotiv dieses Türken, und augenscheinlich ist es auch von Religion geleitet, was die Vokabeln „Christenhunde“ und „Mahomet“ indizieren. Der spielerische Umgang mit dem Thema Polygamie, wie er noch in der librettistischen Vorlage „Das Serail“ (Bozen 1779) zu beobachten war, fehlt hier völlig. In „Zaide“ wird der Sultan als ein von Rachegefühlen Getriebener, als ein Rasender gezeigt. Interessanterweise vollzieht sich diese Schlüsselstelle in einem Melodram, das heißt der Text wird – von Musik durchsetzt – gesprochen; den Autoren war es offenbar wichtig, dass hier jedes Wort verstanden wird.
Mozart und sein Textdichter Johann Andreas Schachtner haben auf diese Weise den türkischen Protagonisten und damit den Konflikt in einer Weise verschärft, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass dieser Sultan am Ende noch eine Kehrtwendung macht und die Europäer freilässt (wie in der Vorlage). Eingedenk der Tatsache, dass Mozart selbst seine Oper als „zu ernst“ empfand, scheint es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass diese „Zaide“ tragisch endete. In jedem Fall wurde der Kulturkonflikt, nicht zuletzt via Religion, in der Gestalt des Sultans dergestalt forciert, dass er die komischen Elemente in diesem Singspiel vollkommen marginalisiert. Hier gab es augenscheinlich nichts zu lachen. Allerdings hatte das Publikum nicht die Gelegenheit, die Oper zu sehen, „Zaide“ kam bekanntlich erst gar nicht auf die Bühne. Ob Vergeltung oder Vergebung am Ende obsiegt, bleibt ein Rätsel der Operngeschichte.
„Der Junge Stephani wird mir ein Neues stück, und wie er sagt, gutes stück, geben...“, schreibt Mozart an seinen Vater am 18. April 1781. Damit wurde ein neues Kapitel in Sachen ,türkisches‘ Singspiel aufgeschlagen: Mozart wendet sich im Frühjahr 1781 der Komposition der „Entführung aus dem Serail“ zu. In der Vorlage „Belmont und Constanze“ (Leipzig 1781) von Christoph Friedrich Bretzner dürfte er genau das gefunden haben, was er in „Zaide“ vermisst hatte: eine Kontrastfolie Orient–Okzident, die aber ungleich mehrschichtiger und schillernder war als in „Zaide“, vor allem weil an ihr mehrere Personen partizipieren. Der religiös induzierte Part kam hier Osmin zu, den Alfred Einstein als „unendlich komisch und unendlich gefährlich“ charakterisierte. In der Tat ist die Unberechenbarkeit des Türken – ein weiteres ‚türkisches‘ Leitmotiv – ganz der Figur des Osmin zugedacht. Die Religion konkretisiert sich hier vor allem im Alkoholverbot des Islam, dem eine eigene Szene (mit Pedrillo) gewidmet ist. Das Subalterne und das Autoritäre halten sich bei Osmin die Waage. Diese schillernde Figur hat Mozart jedoch mit seiner Komposition ungemein aufgewertet. Sie erhielt ein Gewicht, das sie in Bretzners Vorlage zu keiner Zeit besaß. Diese Aufwertung – begleitet von massivem Einsatz ,türkischer Musik‘ – führte indes auch zu Missverständnissen in der Rezeption: Osmin wurde lange Zeit als Haremswächter – als Kislar Aga, eine der ranghöchsten Personen im Serail – gesehen, was er de facto nicht ist. Er ist (nur) der Aufseher über das Landgut des Bassa Selim. Es ist aber Mozarts untrüglichem Theaterinstinkt zu verdanken, dass die Fremden nicht wie in Glucks „La Rencontre imprévue“ oder Haydns „L’incontro improvviso“ (1775) ins dramaturgische Abseits abgleiten, sondern jetzt einem explizit musik-dramatischen Prinzip verpflichtet wurden.
Osmin war also der Part des negativ besetzten Türken zugedacht, und Mozart beschreibt ihn auch entsprechend: „impertinent“, „grober flegel, und Erzfeind von allen fremden“, „dumm, grob und boshaft“. Und dieser bedrohlich-aggressive Grundcharakter scheint – bei aller Komik – überall durch in diesem Stück. Vor allem zeigt sich Osmin absolut starr in seinen Positionen: Selbst als das Happy End schon Gestalt angenommen hat, verharrt der Türke auf dem Vergeltungsprinzip gegenüber den Europäern: „Erst geköpft, dann gehangen“, was Mozart mit einem ungemein modernen Kunstgriff realisierte, indem er das musikalische Material Osmins aus dem I. Akt aufgreift: eine Reminiszenz des unbeugsamen in Angesicht des großen Vergebungsgestus des Paschas.
„Der Bassa ist ein Renegat und hat noch so viel Delikatesse, keines seiner Weiber zur Liebe zu zwingen.“ Dies ist gewissermaßen der dramaturgische Kernsatz, der auch den Konflikt in der „Entführung aus dem Serail“ (in doppelter Hinsicht) zu exponieren vermag. Der Zuschauer wird sehr früh (I. Akt, 4. Auftritt) über dieses Renegatentum des Bassa in Kenntnis gesetzt. Den Grund für die Konversion erfahren wir allerdings erst am Ende des Stücks: Der ehemalige Spanier wurde (durch Belmontes Vater) in seiner Heimat jedweder sozialen Verankerung beraubt, man brachte ihn um „Ehrenstellen, Vermögen, um alles“. Der Orient wurde für den ehemaligen Spanier zu einem Ort der Zuflucht vor dem totalen gesellschaftlichen Ruin. Hier konnte er sein verlorenes Sozialprestige wiedererlangen, nicht zuletzt mit dem für hohe Offiziere und Beamte auf Lebenszeit verliehenen Titel eines Paschas. Für Bassa Selim hat der Orient indes keine Surrogatfunktion, um verlorene europäische Traditionen zu kompensieren, sondern er findet dort die Möglichkeit, das paradigmatisch Andere zu erfahren und zu leben. Die Konversion zum Islam war hierfür die Grundvoraussetzung.
Bassa Selim wurde durch diese dramaturgische Konfiguration a priori eine andere Rolle zuteil als der vom traditionellen Typus des Türken bestimmten Figur des Osmin. Gleichwohl bleibt er der Fremde. Durch sein Renegatentum wird dem Konflikt zwischen Orientalen und Europäern indes ein anderer Akzent verliehen. Reflexion ist das allererste Moment, das hier zu nennen wäre. Der Bassa zeigt sich – trotz seines zwischenzeitlichen Aufbrausens – immer überlegt und reflektiert, Zweifel eingeschlossen. Seine Machtposition bleibt davon untangiert.
Weshalb Mozart gerade diese ambivalente Figur in einer Sprechrolle verharren ließ, ist unerklärlich. In der Auflistung der Rollen schreibt er im September 1781 zu Bassa Selim: „Jautz – hat nichts zu singen.“ Damit war der Sänger-Schauspieler Dominik Jautz gemeint, der den ersten Bassa Selim verkörperte. So war relativ früh klar, dass Mozart der Konzeption als gesprochene Rolle (aus Bretzners Vorlage) zu folgen gedachte. Selim hat auf diese Weise sein eigenes Profil erhalten, auch wenn er keine ,Musikalisierung‘ erfuhr. (Dass er gleichwohl ein gewisses klangliches Potential gewonnen hat, wird deutlich, wenn wir uns die Besetzungstradition im 20. Jahrhundert vergegenwärtigen: Curt Jürgens, Thomas Holtzmann, Edgar M. Böhlke usw., alles sehr ‚sonore‘ Stimmen, die diese Figur verkörpert haben.)
Mit der Konstellation, dass Bassa Selim in Person des Belmonte am Ende den „Sohn seines ärgsten Feindes“ in seiner Gewalt hat, erfuhr das Drama eine überraschende Zuspitzung. Der Weg zur Vergeltung war hier näher als der der Vergebung. Mit der Lösung des Konflikts aus der Leipziger Vorlage konnten sich die Wiener Autoren allerdings kaum anfreunden. Dort entdeckte nämlich der Bassa in Belmonte seinen verloren geglaubten Sohn, der nun leibhaftig vor ihm stand. Diese Lösung durch Überführung ins Private war in jeder Hinsicht unbefriedigend und hätte die dramaturgische Folie des Kulturkonflikts mit einem Schlag entschärft.
Mozart im Besonderen konnte an dieser Schlusslösung nicht das geringste Interesse haben. Zu einem Zeitpunkt der endgültigen Abnabelung vom Vater Leopold wäre ein solches Wiederfinden von Vater und Sohn, wenn auch nur auf der Opernbühne, von ihm sicher als ein persönlicher Rückschritt erachtet worden – vor allem wenn eine Person mit Namen Konstanze beteiligt war ...
Das große Pardon des Bassa Selim musste insofern in der Wiener Version der „Entführung“ umso größere Wirkung entfalten, als die Geste der Vergebung ihren dramaturgischen Halt nicht in einer ‚Familienzusammenführung‘ fand. Der Umstand, dass der Türke die positiven Eigenschaften der Europäer einzunehmen vermochte, untergrub die traditionelle Konstellation einer ,Türkenoper‘, mehr noch entzog sie den Abendländern die Grundlage moralischer Überlegenheit. Da sich hinter dem edlen Türken aber in Wirklichkeit ein Renegat verbarg, der letztlich vom Geist der Aufklärung mehr durchdrungen war als vom Verhaltenskodex der Osmanen, rückte die eurozentrische Sichtweise gleichsam wieder zurecht, vor allem, wenn sie derart demonstrativ an das Phänomen des Fürstenspiegels gebunden war. Denn schließlich sollte sich in Bassa Selim niemand anderer erkennen als der Kaiser– Joseph II.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2018
- S. 48-55
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe