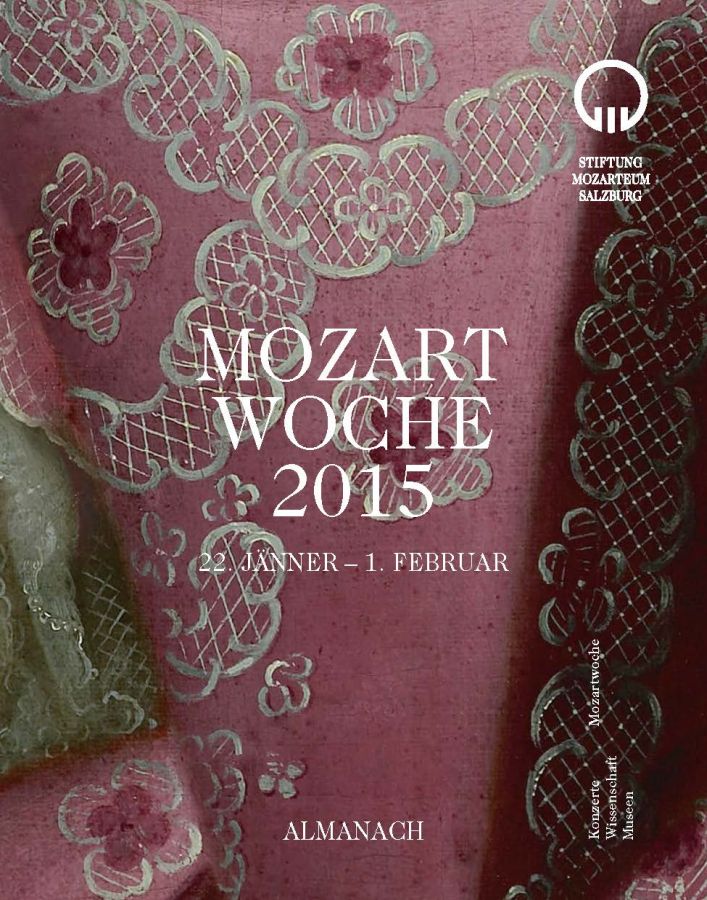- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2015
- S. 92-96
o.T.
Text: Helga Lühning
In: Almanach, Mozartwoche 2015, Internationale Stiftung Mozarteum, S. 92-96 [Programmheft]
Im Herbst 1821 zogen sich die Freunde Franz von Schober und Franz Schubert ins Schloss Ochsenburg nahe Sankt Pölten zurück, um dort in engster Zusammenarbeit eine Oper zu schreiben: Alfonso und Estrella. Schubert „hat fast 2 Akte, ich bin im letzten. […] es ist wunderbar, wie reich und blühend er wieder Gedanken hingegossen hat [...]. Abends referierten wir immer einander, was des Tages geschehen war, ließen uns dann Bier holen, rauchten unsere Pfeife und lasen dazu…“, berichtete Schober nach der Rückkehr an Josef von Spaun. Wenig später, im Februar 1822, war auch der 3. Akt bereits vollendet. Nun begannen vielfältige Bemühungen, die Oper, die Schubert selbst hoch schätzte, auf die Bühne zu bringen. Gedacht war natürlich zunächst an die Wiener Hofoper. Doch weder dort noch in Dresden, Berlin und Graz hatte er Erfolg. Erst lange nach seinem Tod fand im Juni 1854 in Weimar unter der Leitung von Franz Liszt die Uraufführung statt. Schober war eine Zeit lang Liszts Sekretär und hatte den Boden bereitet.
Für Liszt indes war die Aufführung mehr „ein Act der Pietät“, „die Erledigung einer Ehrenschuld“ als ein künstlerisches Anliegen. Die Oper sei „im vollsten Sinn ein Singspiel; sie besteht aus einer Folge von leicht, schön und breit melodisch gehaltenen Gesangstücken. Alles trägt den Stempel von Schuberts Lyrik und Manches dürfte unter das Beste seiner Liedersammlungen aufgenommen werden [...]. Aber der Mangel an scenischer Erfahrung und dramatischer Auffassung wird jeden Augenblick bemerklich und die musikalische Wirkung ist an keiner Stelle mächtig genug, um etwa durch symphonische Vorzüge die Mängel zu vergüten.“ Daher meinte Liszt, das Stück heftig bearbeiten zu müssen. Die Hälfte der Musik wurde gestrichen und neue Einleitungen und Übergänge ergänzt. Doch die Resonanz blieb aus. Wie hätte man zu dieser Zeit, mehr als 30 Jahre nach der Entstehung, einen Zugang zu einem so eigenartigen Werk finden können, das weder klassisch wie Mozarts Opern geworden war, noch aktuell wie Wagner oder Berlioz, in deren Nachbarschaft es nun erschien?
Ein Singspiel, melodisch leicht, schön und breit, aber es mangelt an dramatischer Auffassung − Liszts eloquent vorgebrachte Kritik hat die Rezeption nicht nur des 19. Jahrhunderts geprägt; sie wirkt bis heute nach. Zwei weitere Umarbeitungen hatten zwar vorübergehende Erfolge. Die erste (Johann Nepomuk Fuchs, 1881) stellte die Gesangsnummern um und bezog andere Kompositionen Schuberts ein, während die zweite (Kurt Honolka, Die Wunderinsel, 1958) einen komplett neuen Text unterlegte. Alle drei − Liszt, Fuchs und Honolka − sind davon ausgegangen, dass die Oper entweder gar nicht oder nur zu ,retten‘ sei, wenn man sie völlig umgestaltet, sie quasi vor sich selbst schützt. Die erste szenische Aufführung der Originalfassung fand erst 1977 in englischer Sprache an der Universität Reading, die erste deutschsprachige 1991 im Stadttheater Graz statt − 170 Jahre nach der Entstehung.
Die Handlung ist schnell erzählt: Zwei Königskinder, Alfonso und Estrella, begegnen sich zufällig, verlieben sich ineinander, überwinden die Feindschaft ihrer Väter, des entthronten alten Königs Froila und des Usurpators Mauregato, und werden vereint. Das Sujet hat zwar einen historischen Kern − tatsächlich regierten im 8. Jahrhundert im spanischen Königreich León (Asturien) erst ein Fruela, dann ein Mauregato und schließlich ein Alfonso − doch hat Schober die Handlung erfunden, und zwar gerade nicht als historisierendes Drama, sondern als eine Art romantisches Märchen, dessen Personen nicht in einer bestimmten Zeit oder einem sozialen Gefüge verortet werden. Sie haben keine Herkunft, doch haben sie viele Verwandte, mit denen sie eine Art Großfamilie bilden. Froila erinnert an Sarastro, Alfonso steht etwa in der Mitte zwischen dem „Re pastore“ Aminta und Siegmund, zwischen den Königskindern, die nicht wissen, „wess’ Nam und wess’ Geschlecht“ sie sind. Estrella hingegen hat einiges mit Pamina gemein: sie weiß um ihre Herkunft, die die Verbindung mit ihrem mysteriösen Geliebten behindert. Wie Pamina (Monostatos) hat sie einen Verehrer (Adolfo), dem sie versprochen ist. Er will sie zur Liebe zwingen und wird, abgewiesen, zum Todfeind, den der Geliebte besiegen muss. – In diese Familie lassen sich unendliche viele Opernfiguren einbeziehen. Klare Stammbäume gibt es selbstverständlich nicht.
Auch die Handlungsräume werden nicht konkretisiert. Liszt hatte eine ausführliche Inhaltsübersicht gegeben, aus der die Bilder seiner Aufführung zu entnehmen sind. Danach hat sich (zu Beginn) Froila „in eine Bergschlucht zurückgezogen“; in der Mitte des 1. Aktes verwandelt sich die Szene in den Palast Mauregatos; im 2. Akt „sehen wir Estrella sich während einer Jagd in Froilas Gebirge verirren“; zu Adolfos Offensive versammeln sich die Verschworenen nachts in Ruinen. Das Finale des 2. Aktes spielt selbstverständlich wieder in Mauregatos Palast. Der 3. Akt führt „in eine Froilas Gebirge nahegelegene Gegend“. Möglicherweise hatte Liszt die Angaben zu diesen Szenenbilder, die seine Aufführungspartitur ebenso wenig enthält wie Schuberts Autograph, direkt von Schober. Einige weitere szenische Vorstellungen lassen sich auch aus den Gesangstexten erschließen. Doch über die isolierten Bilder hinaus bleiben die Orte unbestimmt. Wie weit ist etwa das abgeschiedene Tal, in dem der weise Froila mit Alfonso lebt, von Mauregatos Königshof entfernt? Wieso kann Froilas Einsiedelei dort unentdeckt bleiben, Estrella sich aber während eines Jagdausflugs dorthin verirren und dann allein zurück zum Schloss finden? Es sind imaginäre Räume, in denen sich die Personen bewegen wie die sieben Berge, über die Schneewittchen zu den sieben Zwergen gelangt.
Mit der Stoffwahl wurden die Beziehungen zwischen Handlung und Musik, die Aufgaben und das Gewicht der musikalischen Darstellung, die Charakterisierung der Rollen und nicht zuletzt die Möglichkeiten zur Abstraktion in höchst eigenwilliger Weise gefasst. Zur Zeitlosigkeit der Handlung korrespondiert eine gewisse Sprachlosigkeit der Personen. Es gibt keine Dialoge − keine gesprochenen und auch nur wenig gesungene Rezitative. Überspitzt gesagt: die Personen sprechen nicht miteinander, sondern sie tragen Gesänge vor. Sie brauchen auch keine realistische Begründung für ihr Singen. Nur einmal, am Anfang des 2. Aktes, fordert Alfonso den Vater auf, ein Lied zu singen: „das schöne Lied vom Wolkenmädchen“. Aber obwohl Schubert mehrfach von liedhaften, strophisch gegliederten Formen Gebrauch macht, ist gerade Froilas gleichnishafte Erzählung vom Wolkenmädchen kein Lied, auch keine Arie, sondern eine ‚sprechende‘ Ballade mit mehrfachem Wechsel des Gesangsduktus.
Andererseits scheint die Ebene der Dialoge strukturell zu fehlen. Der Bereich der Handlung, der Aktion, der Bezug der Personen zueinander wird dadurch verkürzt. Darüber hinaus fehlt auch musikalisch ein Element des Wechsels, der musikalischen Simplizität, der Prosa zwischen den Gesängen.
Indes hat der weitgehende Verzicht auf Dialoge beziehungsweise Rezitative Schubert zu ganz eigenartigen musikalischen Strukturen geführt, die mit keiner anderen Oper vergleichbar sind. Zur Zeit der Konzeption und Komposition von Alfonso und Estrella vollzogen die traditionellen Operngattungen in ihren dramaturgischen Gestaltungsformen einen tiefgreifenden Wandel. Nicht einmal die Trennung der ernsten und heiteren Genres blieb davon unberührt. Was sich dagegen nur langsam, mehr von den musikalischen Entwicklungen als von reformatorischen Erwägungen ausgehend, veränderte, waren die problematischen Zeitstrukturen der Oper. Die Verschränkung der verschiedenen Zeit-Verläufe war in der italienischen Oper, in der Unterscheidung zwischen handlungsgeprägten rezitativischen Abschnitten und eher kontemplativen Arien und Ensembles, geregelt. Auf diese Regelung schwenkte schließlich auch die französische Oper ein, prägte ihrerseits aber der italienischen Schwester ihre ganz andere szenische, tableau-artige Struktur auf, indem sie anstelle der stereotypen Arienfolgen umfangreiche musikalisch-dramatisch geformte Abschnitte erzeugte.
Die Verknüpfung von italienischer und französischer Oper, die gleichsam in der Luft lag, haben Schober und Schubert offensichtlich aufgenommen − allerdings in eigener, differenzierender Weise. Die Handlung ist nicht in kurze Szenen mit beständigen Auf- und Abtritten gegliedert, sondern tableau-artig inwenige große Zusammenhänge. Die musikalischen Formungen sind dagegen ganz eigenwillige, die nicht allein aus der Tableau-Struktur entwickelt sind, sondern auch andere Grundlagen haben. Vielfach wurden die musikalischen Nummern durch fehlende Schlüsse beziehungsweise auskomponierte Übergänge miteinander verbunden. Andererseits hat Schubert den Verlauf aber konventionell in Arien, Duette und Ensembles gegliedert und diese offenbar auch selbst nummeriert, d. h. als Nummern gekennzeichnet. Die szenisch tableau-artige und die musikalische Nummernfolge stehen sich also gegenüber.
Jenseits der zahlreichen dramatischen Einflüsse und Anregungen, die Schubert umgaben und die sich heute nur noch unvollständig und eher zufällig aufspüren lassen, liegen der musikalisch dramaturgischen Konzeption der Oper offenkundig eigene, eigenwillige Vorstellungen zugrunde. Schubert gestaltet den musikalischen Plan für jede einzelne Nummer neu − mit Blick auf Text und Situation und auf ihre Position im Ganzen. Er stellt dramatische, agogische, motivische, klangliche und tonartliche Verbindungen zwischen den Nummern her, wo immer er kann. Die Nummern werden zwar auf den Gesamtablauf bezogen, behalten aber dennoch ihre musikalische und strukturelle Autonomie. Die wenigen Rezitative werden kaum für den dramatischen Dialog, sondern vor allem als musikalische Überleitungen benötigt.
Die Ideen zu dieser Strategie scheinen von zwei sehr gewichtigen, aber keineswegs konformen musikalischen Konzepten ausgegangen zu sein: von der offenen, vielfältigen, bei Schubert (in unterschiedlicher Gestalt) immer wiederkehrenden Vorstellung zyklischer Verbindung einerseits und von der vergleichsweise geschlossenen und musikalisch erprobten Konzeption des Opernfinales andererseits. Dass die Nummern einer Oper eine Art musikalisch-dramatischen Zyklus bilden sollten, ist als Vorstellung schon in der Oper des 18. Jahrhunderts erkennbar und hatte seither sowohl unter musikalischen als auch unter dramatischen Prämissen immer stärkere Konturen gewonnen. Bei Alfonso und Estrella kommen dazu aber vor allem Schuberts besondere Erfahrungen mit den Zyklen der Instrumentalmusik und mit den diversen Verbindungen zwischen Liedern und innerhalb großer Vokalkompositionen.
Keine reihenden Zyklen, sondern große zusammenhängende Komplexe, allerdings fast ohne regelhafte formale Festlegung, stellen die Finali der Opera buffa und des Wiener Singspiels dar. Ein struktureller Bezug zu Schuberts Oper besteht zunächst darin, dass auch sie weitgehend ohne Rezitative auskommen; die musikalisch-dramatische Gliederung folgt anderen Intentionen. Sie bildet eine Abfolge mal mehr, mal weniger bewegter Personen und Gruppenbilder. Nicht durch Dialoge, sondern durch diese kurzen Szenen in einheitlicher musikalischer Bewegung, durch ihre Abfolge muss Handlung erzählt und dramatische Spannung erzeugt werden. In den Finali, deren Meister bekanntlich Mozart war, stellt sich ein sehr vielfältiges und dennoch ganz spezifisches Verhältnis zwischen Drama und Musik her. In der Zauberflöte etwa spielt sich mehr als die Hälfte der Musik in den beiden Finali ab. Nimmt man dort noch die beiden anderen großen Ensembles: die Introduktion und das erste Quintett hinzu, dann besteht die Oper zu zwei Dritteln aus umfangreichen musikalischen Komplexen, zwischen denen ein paar versprengte kurze Arien und Ensembles gesungen werden und allerdings lange, gattungsbestimmende Sprechtexte stehen.
Mit der Zauberflöte ist jedoch eine Grenze erreicht, denn das Prinzip ließ sich nicht weiterführen. Schubert hat daher auch nicht versucht, die Finali weiter zu verlängern (was zu einer Art durchkomponierter Oper geführt hätte), sondern er hat sie gewissermaßen von innen heraus erweitert, indem er ihre einzelnen Abschnitte dehnte und zu größerer musikalischer und formaler Selbständigkeit ausbaute. Diese Vorstellung von einem aufgeblähten Finale, aus dem die musikalischen Strukturprinzipien eines ganzen Opernaktes entstehen, scheint konstruiert. Indes bestehen zwischen den großen Finali und Schuberts Alfonso und Estrella in den Verbindungen von dramatischer Darstellung und den Funktionen der Musik klare Entsprechungen.
Freilich lassen sich die Rätsel, die dieses großartige und ganz vereinzelt dastehende Werk aufgibt, nicht leicht lösen. Sie sind seine gerechte Forderung für die sträfliche Vernachlässigung und die Fülle willkürlicher Missverständnisse, die ihm widerfuhren.
- Quelle:
- Almanach
- Internationale Stiftung Mozarteum
- Mozartwoche 2015
- S. 92-96
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe