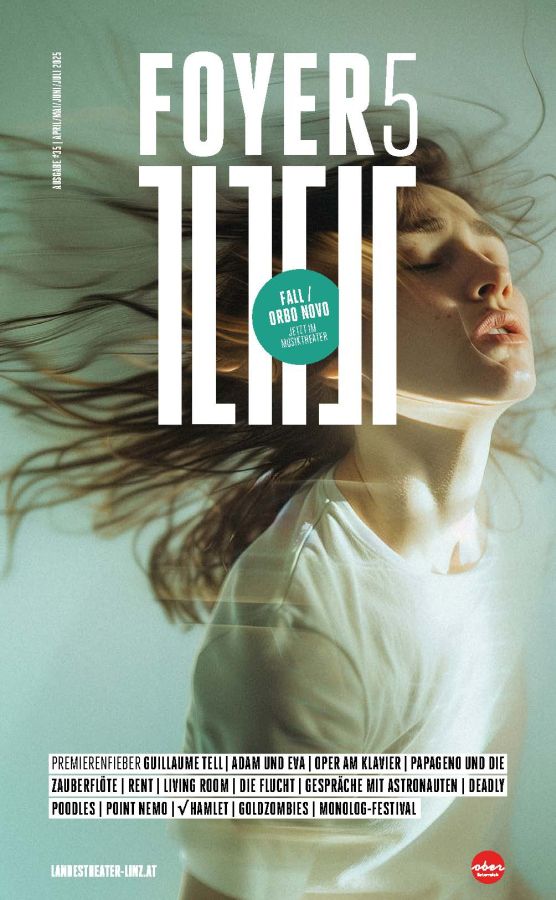Premierenfieber | Guillaume Tell (Wilhelm Tell)
Vom Klang des Heimwehs
Die Schweiz und ihre Kuhreihen
Text: Christoph Blitt
In: Foyer5, # 35 | April-Juli 2025, Landestheater Linz, S. 10-13 [Publikumszeitschrift]
„Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge … Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus’. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein … Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein!“ – Mit diesen Worten hub der Titelsong zu jener japanischen Zeichentrickserie an, die hierzulande von 1977 an ganze Generationen von Kindern das Schicksal der wohl berühmtesten kleinen Schweizerin näherbrachte. Es war die aus dem Kanton Zürich stammende Autorin Johanna Spyri gewesen, die 1880 und 1881 mit ihren beiden Heidi-Romanen diesen Mythos begründete. Mag mancher die angesprochene Comic-Serie als zu kommerziell abtun, so muss doch konstatiert werden, dass bereits der zitierte Titelsong einen Topos anklingen lässt, den man schon seit Jahrhunderten mit der Schweiz in Verbindung bringt. Die Rede ist von der Auffassung, dass der Schweizer sich nur wirklich glücklich fühlt, wenn er auch in seinem idyllischen Heimatland leben kann. Dementsprechend stammen auch die ersten Quellen, die sich dem Phänomen „Heimweh“ widmen, aus der Schweiz. „Heimweh“ konnte als eine Sonderform der Melancholie oder Monomanie auch durchaus krankhafte Züge annehmen und massive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben bis hin zu Entkräftung, Auszehrung, Fieber und Tod. Früher sprach man bei diesen Symptomen bezeichnenderweise auch von der „Schweizer Krankheit“.
Warum aber waren es vor allem Bewohner dieses Alpenlandes, die davon betroffen waren? Dies hatte vor allem zwei Ursachen. Zum einen gingen seit dem Mittelalter viele Schweizer Männer, die in ihrer rauen Gebirgsheimat kein Auskommen fanden, ins Ausland, wo sie sich in der Regel als Söldner verdingten. Hier in der Fremde waren sie dann besonders anfällig für das Heimweh. Der zweite Grund, warum insbesondere die Schweiz als Ziel einer wehmütigen Sehnsucht galt (und vielleicht immer noch gilt), ist eher allgemeineren Charakters. Er liegt schlicht und einfach begründet in der beeindruckenden und überwältigen den Naturschönheit dieses Landes mit seinen Alpenpanoramen, seinen satt-grünen Wiesen und seinen malerischen Dörfern. Jeder konnte also verstehen, dass sich ein Eidgenosse außerhalb seiner Heimat nach selbiger zurücksehnte.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde schließlich die Schweiz nahezu für alle Europäer zu einem Ort, an dem Träume wahr zu werden schienen. Es war ein Land, in dem der Mensch – wie man damals dachte – noch vollkommen mit der Natur im Einklang lebt. Für all diejenigen, die in der modernen Zivilisation eine Entfremdung zwischen dem Einzelnen und seiner Umwelt feststellten, galt die Schweiz somit als das wahre Paradies.
Für beide Formen der Schweiz-Sehnsucht – für das Heimweh der Eidgenossen und für den Wunsch der anderen nach einem Leben im Einklang mit der Natur – gab es damals eine ganz bestimmte klanglich-musikalische Chiffre: Den Kuhreihen. Dabei handelt es sich um instrumentale oder gesungene Weisen, mit denen man in den Schweizer Alpen die Kühe zum Melken anlockt. Diese Kuhreihen hatten einen ganz eigenen, mit kaum etwas zu vergleichenden Charakter. Angeblich war es deshalb den Schweizer Söldnern im Ausland verboten, einen Kuhreigen erklingen zu lassen, da derartige Melodien in ganz besonderem Maße dazu angetan waren, in den Soldaten Heimweh zu wecken.
Der Sage nach tauchten einst eines Nachts in der Hütte eines Schweizer Senns drei Männer auf: Ein starker Riese, ein Jäger und ein wunderschöner blond gelockter Jüngling. Sie machten sich am Käsekessel zu schaffen. Der Jüngling goss die Milch hinein, der Jäger fügte blutrotes Lab hinzu und der Riese rührte die Milch. Währenddessen blies der blonde Jüngling auf seinem Alphorn eine ganz wundersame Melodie von einer Schönheit, die der Senn noch nie vernommen hatte. Auch die Kühe kamen aus dem Stall, um zu lauschen, wobei sich der Klang ihrer Glocken auf wunderbare Art mit der Weise des Jünglings vermischte. Als der Riese am Kessel fertig war, verstummte auch die Musik und der Riese füllte aus dem Kessel drei Gefäße mit Milch. Doch obwohl alles aus einem Kessel stammte, war die Milch in dem einen Gefäß rot, im anderen grün und im dritten weiß. Da riefen die drei Männer den ängstlichen Senn zu sich und forderten ihn auf, eines der Gefäße zu wählen. Nimmt er die rote Milch, wird er stark wie der Riese sein. Entscheidet er sich für die grüne, verspricht ihm der Jäger großen Reichtum.
Wählt er aber die weiße Milch, so wird der Senn so wunderschön singen und auf seinem Horn blasen können wie der blonde Jüngling. Dem Senn fiel die Wahl nicht schwer und er griff zur Schale mit der weißen Milch. Seitdem übt der Kuhreihen unter den Menschen seine mit nichts zu vergleichende Faszination aus.
Die im späten 18. Jahrhundert einsetzende Schweiz-Begeisterung des restlichen Europas sorgte dann auch dafür, dass originale oder stilisierte Kuhreihenmelodien Eingang in die europäische Kunstmusik fanden: Ob Ludwig van Beethovens Sechste Sinfonie, Joseph Weigls damals extrem populäre Oper Die Schweizerfamilie, Franz Schuberts Lied Der Hirt auf dem Felsen, Hector Berlioz’ Symphonie fantastique oder Wagners Tristan und Isolde: Dies ist nur ein kleiner Teil der Kompositionen, die Kuhreihenweisen aufgreifen und in denen die Sehnsucht nach der heilen Welt der Schweizer Idylle ihre Spuren hinterlassen hat. Und natürlich lässt es sich auch Gioachino Rossini nicht nehmen, in seinem Guillaume Tell einen Kuhreihen erklingen zu lassen. Ausgefuchster Musikdramatiker der er war, handelt es sich bei Rossini aber um alles andere als ein nur oberflächliches klangliches Lokalkolorit. Denn der Komponist kontrastiert diese wehmütigen „Schweizer Klänge“ mit scharfen Signalen aus den Hörnern der Habsburger und überträgt so den Konflikt zwischen den Schweizern und ihren Unterdrückern auch auf eindrückliche Weise in seine Musik.
GUILLAUME TELL (WILHELM TELL)
OPER IN VIER AKTEN VON GIOACHINO ROSSINI
Text von Étienne de Jouy und Hippolyte Bis nach dem gleichnamigen Schauspiel von Friedrich Schiller und nach der Erzählung Wilhelm Tell oder Die befreite Schweiz von Jean Pierre Claris de Florian
In französischer Sprache mit Übertiteln
Premiere 17. Mai 2025
Großer Saal Musiktheater
Musikalische Leitung Enrico Calesso Inszenierung Georg Schmiedleitner Bühne Harald B. Thor Kostüme Tanja Hofmann Lichtdesign Stefan Bolliger Dramaturgie Christoph Blitt Chorleitung Elena Pierini, David Barnard
Mit Adam Kim (Tell), SeungJick Kim (Arnold), Dominik Nekel (Walter Furst), Michael Wagner (Melcthal), Fenja Lukas (Jemmy), Gregorio Changhyun Yun (Gesler), Christian Drescher (Rodolphe), Jonathan Hartzendorf (Roudi), Erica Eloff (Mathilde), Angela Simkin (Hedwige) u. a.
Chor des Landestheaters Linz
Extrachor des Landestheaters Linz
Statisterie des Landestheaters Linz
Bruckner Orchester Linz
1829 ereignete sich eine musikalische Revolution in Paris, als Gioachino Rossini seine Oper Guillaume Tell zur Uraufführung brachte. Denn dieses Werk entfaltet ein bis dahin – im wahrsten Sinne des Wortes – unerhörtes Ausdrucksspektrum: Idyllische Naturschilderungen stehen hier neben mitreißenden Chorszenen, verinnerlichte Sologesänge von berührender Emotionalität treffen auf vor Energie berstende Passagen.
Und so findet Rossini immer genau den richtigen Ton, um Friedrich Schillers populäres Drama über den Freiheitskampf der Schweizer für die Musiktheaterbühne zu gewinnen. Den Kampf der besetzten Schweiz gegen ihre brutalen Unterdrücker weitet Georg Schmiedleitner in seiner Inszenierung für das Linzer Landestheater zu einer Auseinandersetzung mit den immer aktuellen Fragestellungen über das Entstehen und die Mechanismen radikaler Bewegungen.
Weitere Vorstellungen
27. Mai, 14., 22. Juni 2025
Einführung ½ Stunde vor Beginn der Vorstellung
Wiederaufnahme 2025/2026
12. September 2025
- Quelle:
- Foyer5
- Landestheater Linz
- # 35 | April-Juli 2025
- S. 10-13
PDF-Download
Artikelliste dieser Ausgabe