Kalchschmids Albenpanorama
10/2025
Tipps im Oktober: ein Lockdown-Nachzügler mit ausdrucksstarken Kontrasten, eine gigantisch aufrauschende, kroatische Oper und ein Brückenschlag über vier Jahrhunderte
Klaus Kalchschmid • 13. Oktober 2025
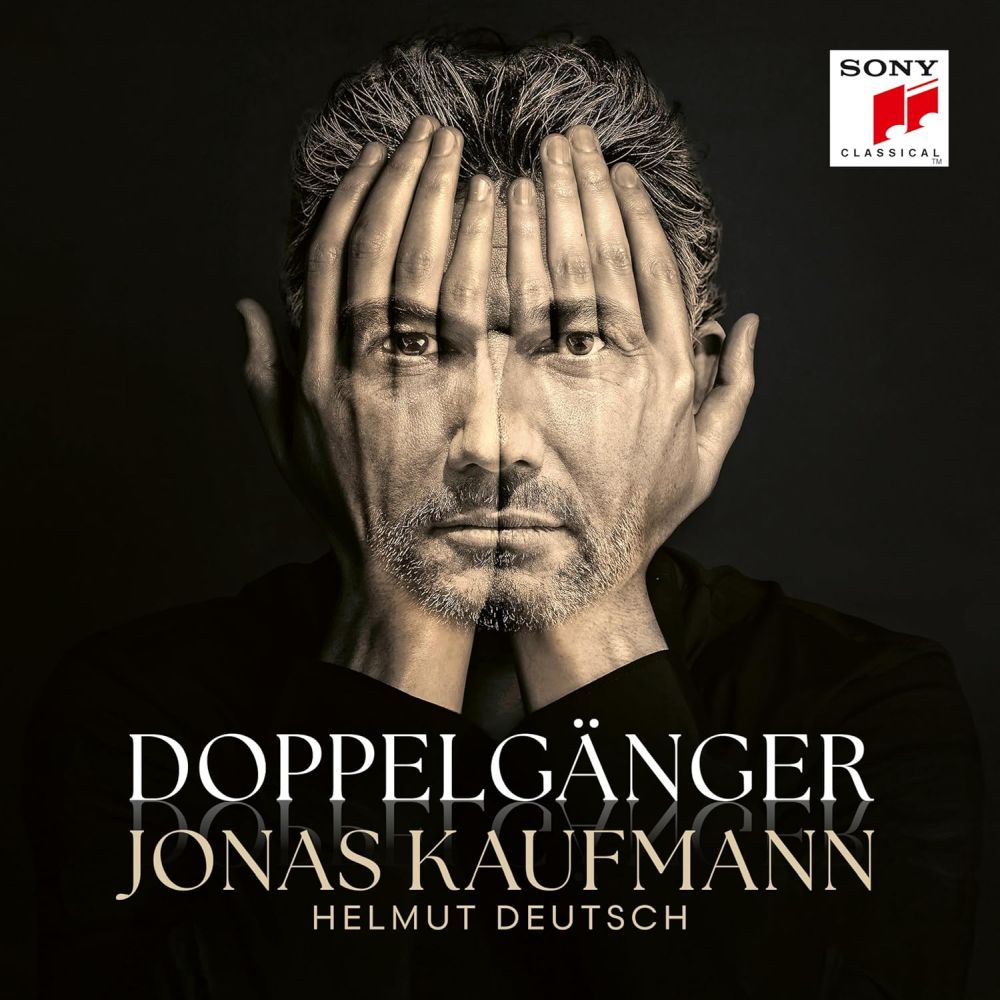 „Doppelgänger“ nennt sich Jonas Kaufmanns neues Album mit der «Dichterliebe» von Robert Schumann und einem New Yorker Livemitschnitt einer szenischen Fassung durch Claus Guth von Franz Schuberts «Schwanengesang» von 2025. Auf 70 Feldbetten und inmitten zahlreicher Soldaten erfahren die Lieder des «Schwanengesangs» bis hin zum abgründigen „Doppelgänger“ als letztem Lied eine spannende Spiegelung. Die «Dichterliebe» entstand während des ersten Lockdowns, und man hört einerseits die Gelöstheit von Kaufmanns Tenor wie auch das dringende Bedürfnis wieder zu musizieren. Die ersten sechs Lieder gehen fast ineinander über, bevor mit „Im Rhein, im heiligen Strome“ und „Ich grolle nicht“ ein ganz anderer Ton angeschlagen wird. Diese Kontraste reizen Kaufmann und Helmut Deutsch auch später aus, wenn aus der glücklichen Liebe eine zutiefst unglücklich tränenreiche geworden ist, voller Albträume und nüchterner Erkenntnis („Ein Jüngling liebt ein Mädchen“). Die „Kerner-Lieder“ op. 35 sind aus anderem Holz geschnitzt, erzählen von Naturverbundenheit und männlichem Selbstbewusstsein, so gleich zu Beginn, im „Wanderlied“ oder bei der „Wanderung“. Erst gegen Ende manifestiert sich auch hier Liebesleid, ein mit höchster Emphase gesungenes „und morgens dann ihr meinet, stets fröhlich sei sein Herz“ bis hin zu „Dass ich trag Todeswunden, das ist der Menschen Tun: Natur ließ mich gesunden, sie lassen mich nicht ruhn“. Kaufmann setzt wieder auf minutiöse Textausdeutung wie großen Ausdruck. Mehrfach wagt er ein Pianissmo, wie am Ende von „Auf das Trinkglas eines Freundes“. Spannend sind die sechs Bonus-Tracks mit einer Aufnahme des 25-jährigen Studenten Kaufmann der ersten Lieder der «Dichterliebe»: „Schönes Material, eine biegsame, weiche Tenorstimme, aber man hört dass die Stimme beim Übergang in die Höhe noch zu eng klingt“, so Kaufmann selbst. (Sony Classical)
„Doppelgänger“ nennt sich Jonas Kaufmanns neues Album mit der «Dichterliebe» von Robert Schumann und einem New Yorker Livemitschnitt einer szenischen Fassung durch Claus Guth von Franz Schuberts «Schwanengesang» von 2025. Auf 70 Feldbetten und inmitten zahlreicher Soldaten erfahren die Lieder des «Schwanengesangs» bis hin zum abgründigen „Doppelgänger“ als letztem Lied eine spannende Spiegelung. Die «Dichterliebe» entstand während des ersten Lockdowns, und man hört einerseits die Gelöstheit von Kaufmanns Tenor wie auch das dringende Bedürfnis wieder zu musizieren. Die ersten sechs Lieder gehen fast ineinander über, bevor mit „Im Rhein, im heiligen Strome“ und „Ich grolle nicht“ ein ganz anderer Ton angeschlagen wird. Diese Kontraste reizen Kaufmann und Helmut Deutsch auch später aus, wenn aus der glücklichen Liebe eine zutiefst unglücklich tränenreiche geworden ist, voller Albträume und nüchterner Erkenntnis („Ein Jüngling liebt ein Mädchen“). Die „Kerner-Lieder“ op. 35 sind aus anderem Holz geschnitzt, erzählen von Naturverbundenheit und männlichem Selbstbewusstsein, so gleich zu Beginn, im „Wanderlied“ oder bei der „Wanderung“. Erst gegen Ende manifestiert sich auch hier Liebesleid, ein mit höchster Emphase gesungenes „und morgens dann ihr meinet, stets fröhlich sei sein Herz“ bis hin zu „Dass ich trag Todeswunden, das ist der Menschen Tun: Natur ließ mich gesunden, sie lassen mich nicht ruhn“. Kaufmann setzt wieder auf minutiöse Textausdeutung wie großen Ausdruck. Mehrfach wagt er ein Pianissmo, wie am Ende von „Auf das Trinkglas eines Freundes“. Spannend sind die sechs Bonus-Tracks mit einer Aufnahme des 25-jährigen Studenten Kaufmann der ersten Lieder der «Dichterliebe»: „Schönes Material, eine biegsame, weiche Tenorstimme, aber man hört dass die Stimme beim Übergang in die Höhe noch zu eng klingt“, so Kaufmann selbst. (Sony Classical)
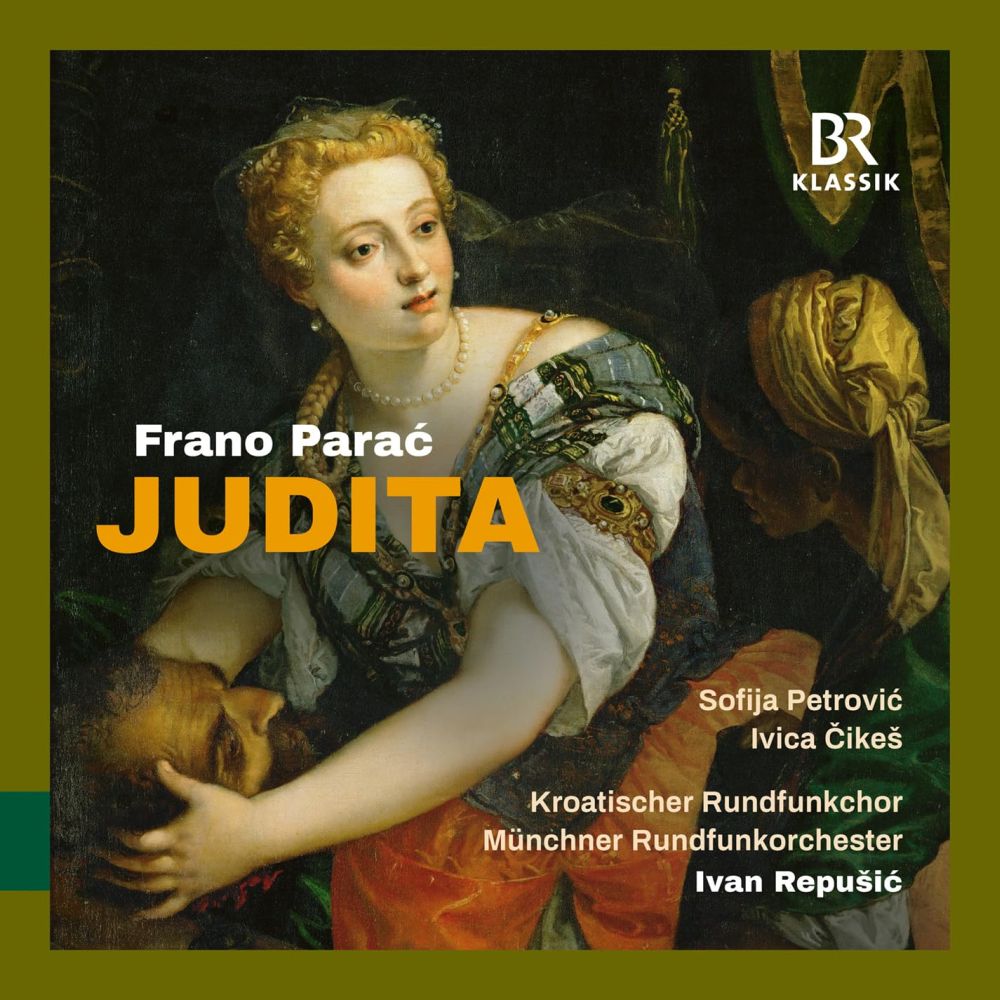 Was ist das für ein gigantisch aufrauschendes Finale, nachdem Judita den Gegner Holofernes durch Verführung und anschließender Enthauptung in seinem Lager als assyrischer Feldherr ausgeschaltet hat! Der Chor preist sie als ihre Retterin, Judita aber überstrahlt alle, wie sie schon das Finale erster Akt mit einer elegischen Arie dominierte und ihre Auseinandersetzung mit dem Volk oder Holofernes musikdramatische Brisanz besaß. Vor allem dieses Finale von Frano Paraćs «Judita», uraufgeführt 2000, klingt überbordend gleißend und enorm effektvoll, vom Kroatischen Rundfunkchor ebenso exzellent gesungen wie von Sofija Petrović mit Durchschlagskraft und betörendem Lirico-spinto-Sopran dargeboten. Bis es dahin kommt, gibt es in zwei Akten konzentrierte sieben geschickt instrumentierte Szenen zwischen Stadtrat, Stadtplatz und dem Heerlager des Holofernes, die gerade mal 75 Minuten ausmachen. Große, klagende Chorszenen der Einwohner von Betulia, die unter der Belagerung durch die Assyerer leiden, klingen raffiniert verdichtet mit Anklängen an traditionelle kroatische Musik. Der Kroatische Rundfunkchor singt das mit bestechender Authentizität. Aber auch ein musikalisch abgründig schillerndes Festmahl mit Judita und Holofernes gibt es. Nie verlässt die Musik dabei den Rahmen der Tonalität, selbst wenn sie diese bis an ihre Grenzen auslotet. Manch minimalistische Struktur kennt sie oder verblüfft mit spannenden Anleihen bei Carl Orff.
Was ist das für ein gigantisch aufrauschendes Finale, nachdem Judita den Gegner Holofernes durch Verführung und anschließender Enthauptung in seinem Lager als assyrischer Feldherr ausgeschaltet hat! Der Chor preist sie als ihre Retterin, Judita aber überstrahlt alle, wie sie schon das Finale erster Akt mit einer elegischen Arie dominierte und ihre Auseinandersetzung mit dem Volk oder Holofernes musikdramatische Brisanz besaß. Vor allem dieses Finale von Frano Paraćs «Judita», uraufgeführt 2000, klingt überbordend gleißend und enorm effektvoll, vom Kroatischen Rundfunkchor ebenso exzellent gesungen wie von Sofija Petrović mit Durchschlagskraft und betörendem Lirico-spinto-Sopran dargeboten. Bis es dahin kommt, gibt es in zwei Akten konzentrierte sieben geschickt instrumentierte Szenen zwischen Stadtrat, Stadtplatz und dem Heerlager des Holofernes, die gerade mal 75 Minuten ausmachen. Große, klagende Chorszenen der Einwohner von Betulia, die unter der Belagerung durch die Assyerer leiden, klingen raffiniert verdichtet mit Anklängen an traditionelle kroatische Musik. Der Kroatische Rundfunkchor singt das mit bestechender Authentizität. Aber auch ein musikalisch abgründig schillerndes Festmahl mit Judita und Holofernes gibt es. Nie verlässt die Musik dabei den Rahmen der Tonalität, selbst wenn sie diese bis an ihre Grenzen auslotet. Manch minimalistische Struktur kennt sie oder verblüfft mit spannenden Anleihen bei Carl Orff.
Gegen die selbstbewusste, schöne und verführerische Judita können sich selbst Holofernes (der stimmgewaltige Bariton Ivica Čikeš) oder der nicht minder herausragende Bassbariton Sava Vemić als Oberpriester Eliakim kaum behaupten. Er will die Stadt dem Feind ausliefern, um das Leben der Bevölkerung zu retten. Für kleine Rollen hat man unter anderen so hervorragende Solisten wie Diana Haller oder Landsmänner wie Matija Meić und Matteo Ivan Rašić vom Gärtnerplatztheater verpflichtet. Der gebürtige Kroate Ivan Repušić lässt sich in dieser Deutschen Erstaufführung zum 500. Todestag von Marko Marulić, von dem die Vorlage der Oper stammt, am Pult seines Münchner Rundfunkorchester von der Theatralik der Oper Paraćs nicht zu übergroßer Intensität verleiten, sondern setzt auf rhythmische Prägnanz und Schärfe sowie große Klangsinnlichkeit. Leider gibt es im Booklet außer einer deutschen Inhaltsangabe kein Libretto auf Deutsch. (BR Klassik)
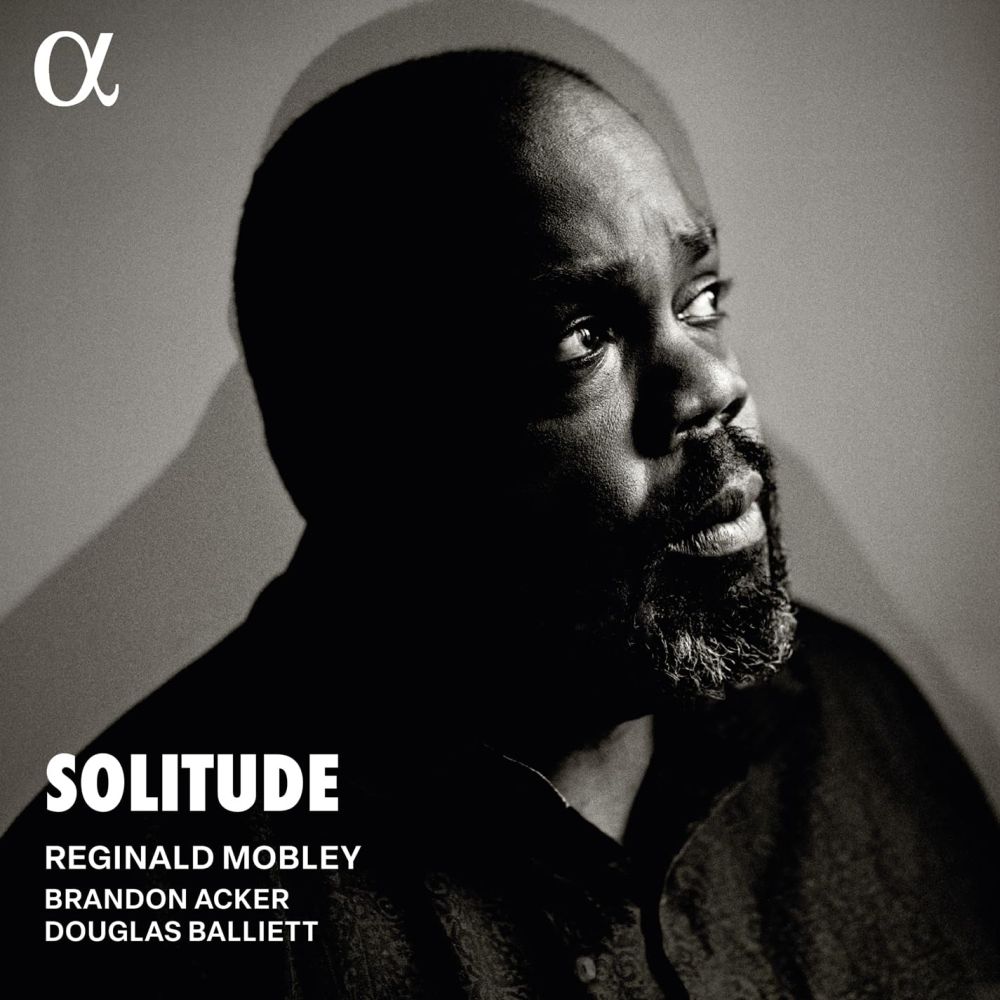 „Solitude“ nennt Countertenor Reginald Mobley sein Album mit Musik von Dowland und Purcell über die Romantik bis zur Gegenwart und zwei Stücken von Douglas Balliett. Er spielt in dieser wunderbaren Aufnahme auch Kontrabass und Gambe, während Brandon Acker an Theorbe, Gitarre und Basslaute zu hören ist. Durch die Verwendung dieser alten Instrumente und eines zeitlosen Stils der Kompositionen von Jonathan Woody aus dem 21. und feinen Strophenlieder aus dem 19. Jahrhundert von William Marshall Hutchison, Caroline Norton und Henry Clay Work klingt dieses Album wie aus einem Guss. So gelingt ein Brückenschlag über vier Jahrhunderte, wie ihn umgekehrt der Countertenor Jakub Jozéf Orlinski gelang, der Barock-Arien in #LetsBaRock neue instrumentale Kleider verpasste. Mobley beginnt mit der Beschwörung der Musik in „Tis Natures Voice“, dem berühmten „Music for a while“ Purcells und seinem „O solitude, my sweetest choice“ und widmet auch John Dowland („Flow my tears“, Sorrow, stay, „Fortune myfoe“, „The time stands still“) einen Block. Reizvoll die fast rhapsodisch freien Stücke von Samuel Pepys in der Bearbeitung von Cesare Morelli. Wie alles sind auch diese Songs ungemein fein und innig ausdrucksvoll gesungen mit einer weichen, gehaltvollen und biegsamen Alt-Stimme, die wir am Ende gar dreistimmig hören. Im Booklet abgedruckt sind die englischen Originaltexte mit französischen Übersetzungen. Die Essays von Mobley und Joseph Newsome gibt es auch auf Deutsch. (Alpha)
„Solitude“ nennt Countertenor Reginald Mobley sein Album mit Musik von Dowland und Purcell über die Romantik bis zur Gegenwart und zwei Stücken von Douglas Balliett. Er spielt in dieser wunderbaren Aufnahme auch Kontrabass und Gambe, während Brandon Acker an Theorbe, Gitarre und Basslaute zu hören ist. Durch die Verwendung dieser alten Instrumente und eines zeitlosen Stils der Kompositionen von Jonathan Woody aus dem 21. und feinen Strophenlieder aus dem 19. Jahrhundert von William Marshall Hutchison, Caroline Norton und Henry Clay Work klingt dieses Album wie aus einem Guss. So gelingt ein Brückenschlag über vier Jahrhunderte, wie ihn umgekehrt der Countertenor Jakub Jozéf Orlinski gelang, der Barock-Arien in #LetsBaRock neue instrumentale Kleider verpasste. Mobley beginnt mit der Beschwörung der Musik in „Tis Natures Voice“, dem berühmten „Music for a while“ Purcells und seinem „O solitude, my sweetest choice“ und widmet auch John Dowland („Flow my tears“, Sorrow, stay, „Fortune myfoe“, „The time stands still“) einen Block. Reizvoll die fast rhapsodisch freien Stücke von Samuel Pepys in der Bearbeitung von Cesare Morelli. Wie alles sind auch diese Songs ungemein fein und innig ausdrucksvoll gesungen mit einer weichen, gehaltvollen und biegsamen Alt-Stimme, die wir am Ende gar dreistimmig hören. Im Booklet abgedruckt sind die englischen Originaltexte mit französischen Übersetzungen. Die Essays von Mobley und Joseph Newsome gibt es auch auf Deutsch. (Alpha)